
Wie werden wir in Zukunft arbeiten?
Verena Gonsch zur Zukunft der Arbeit
Bildung
Die Bildung der ZukunftHeute für morgen lernen

Grundschule
Digitale Medien in der Grundschule
Michaela May leitet eine Grundschule. Sie erklärt, wie die Lehrer an ihrer Schule digitale Medien einbindet und wie das Nebeneinander von Stift und Tablet, Lehrbuch und Tablet und Pause und Smartphone gelingt:
"Wir haben schon in der ersten Klasse gelernt, wie man den Computer anschaltet und mit den Programmen arbeitet. Meine Freunde von anderen Schulen konnten das noch nicht."
"Das Arbeiten mit dem Computer macht total viel Spaß und ich mache auch die Übungen lieber."
"Es ist interessanter mit dem Computer zu arbeiten und auch die ganzen Programme kennenzulernen."
"Durch die unterschiedlichen Medienhilfsmittel lässt sich der Unterricht noch vielseitiger gestalten."
"Wir können Aufgaben im Team und auch alleine lösen."
"Wenn ich mal nicht wo mitkomme, dann kann ich einfach eine leichtere Aufgabe auswählen."
"Mir macht es am meisten Spaß, wenn wir Videos schauen."
"Ich finde es total cool, dass ich jetzt weiß, wie man Präsentationen macht. Mein Papa kann das nämlich nicht."
Unterricht mit Digitalen MedienNeues lernen im geschützten Raum
Lehrern wird der mediale Unterrichtsalltag von "Learning Apps" erleichtert. Mithilfe dieser Anwendung können sie zum Beispiel ganz einfach interaktive Quiz selbst erstellen.
Zeitsprung in der MedienbildungGestern und MorgenBuch vs. Tablet
Was sich gewandelt hat? Klicken Sie auf den "Gestern/Morgen"-Button und verschieben Sie den Regler!
Weiterführende Schulen
Weiterführende SchulenKlassenbuch, Prüfung, Bibliothek – jetzt auch digitalMEBIS - Die Lernplattform
Am Gymnasium Veitshöchheim ist die Lernplattform MEBIS ein Schritt hin zur virtuellen Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern ...

MEBIS - Die Plattform für Schüler und Lehrer

Die Mediathek beinhaltet vielfältige, urheberrechtlich geschützte Video- oder Bildmaterialien, sowie Texte die den Schülern im Netz zugänglich sind. Dieses Werkzeug unterstützt Schulkinder bei Referaten, Hausarbeiten oder Recherchen und ersetzt damit die herkömmliche Schulbibliothek.
Das virtuelle Klassenzimmer ist besonders für Lehrkräfte interessant: Hier werden Unterrichtsmaterialien oder Hausaufgaben hochgeladen und der gesamten Klasse Mitteilungen gesendet.
Abschließend ist der Prüfungsbereich das Werkzeug, welches die Leistungsüberprüfung auf die virtuelle Ebene hebt. Im Netz kann die Lehrkraft Übungen und Tests erstellen, deren Ergebnisse auswerten und so den Lernerfolg beobachten. Dies aber unverbindlich: aus Gründen des Datenschutzes ist eine angerechnete Prüfungsleistung derzeit nicht über die MEBIS-Plattform zulässig.

Sarafina, 18 Jahre
"An MEBIS finde ich gut, dass man mit seinen Lehrern kommunizieren kann."
Kathrin, 18 Jahre
"Die Plattform ist gut für Übungen und Vorbereitungen auf Schulaufgaben."
Tim, 16 Jahre
"MEBIS ist ein guter Schritt in die richtige Richtung."
Alex Schubert, Lehrer
"Ich nutze MEBIS [...] vor allem für die Arbeit der Schüler zu Hause."
Dieter Brückner, Schulleiter
"Wenn MEBIS seine positive Entwicklung fortsetzt, wird es DAS Instrument sein können."
Weiterführende SchulenChancen und Herausforderungen
Denn nur wenn die neuen Lösungen zuverlässig sind, werden sie von den Lehrkräften im Schulalltag angenommen.
Schließlich bildet das Schlüsselelement die pädagogische Vorarbeit in Form von Medienerziehung und Fortbildungen. Sie wird mit Schülern und Lehrern gleichermaßen erfolgen müssen, um nachhaltig eine digitale Arbeitswelt in den Lehrstätten der Zukunft zu etablieren.
Berufsbildung
Ausbildung
Digitalisierung im Handwerk
E-Learning Konzepte
Lernplattformen, Software zur Prüfung von Lernerfolgen, Videos, Simulationen oder Massive Open Online Courses werden aber noch unterdurchschnittlich genutzt.
Tatsächlich messen Betriebe und Berufsschulen der Digitalisierung unterschiedliche Bedeutung bei.
Betriebe müssen dabei oft aufgrund ihrer Größe entscheiden, ob sie weitere Investitionen in die digitale Entwicklung leisten können und wollen. Bei den Berufsschulen ist es Aufgabe des Staates sie mit den nötigen Mitteln für einen Fortschritt in der Berufsbildung auszustatten.
Und, was hast du heute gemacht?
Lehrerbildung
Virtual Reality in der Lehrerbildung‘Breaking Bad Behavior‘
Das Projekt ‘Breaking Bad Behavior‘ setzt Virtual-Reality-Technologien ein um Lehrer auf die Schulrealität vorzubereiten.
Willkommen im virtuellen Klassenzimmer
Zunächst setzt der Kursteilnehmer eine VR-Brille auf. Er taucht ins virtuelle Klassenzimmer und wird mit verschiedenen Stresssituationen konfrontiert. Die virtuellen Schüler besitzen ein breites Aktionssprektrum: Sie werden unruhig, sprechen mit ihren Nachbarn, pfeifen, tanzen ...
Ein anderer Kursteilnehmer kontrolliert vom Rechner aus, wie sich die virtuellen Schüler verhalten.
Feedback aus der GruppeEin Klassenzimmer voller Lehrer
Die Teilnehmer verfolgen am Bildschirm, wie der angehende Lehrer auf das Verhalten der virtuellen Schüler reagiert. Im Anschluss reflektieren die Studierenden, ob sich der Kommilitone richtig verhalten hat und welche Alternativlösungen es gibt.
Ein Unterschied zum Praktikum in einer Schule: Ein ganzer Kurs kann das Vorgehen der Lehramtsstudierenden beobachten und sofort diskutieren.
Von Studierenden für Studierende
"Wir haben ins technische Equipment investiert, aber natürlich sind wir nicht vergleichbar mit ‘EA Games‘ oder ‘Ubisoft‘", meint Seufert zu den Herausforderungen des Projekts. VR-Simulationen sind aufwendig, wie ein modernes Videospiel sieht das virtuelle Klassenzimmer nicht aus – aber die Virtuelle Realität hilft den angehenden Lehrern ins Klassenzimmer einzutauchen.
Die Studenten von ‘Human Computer Interaction‘ entwickelten die wichtigsten Komponenten selbstständig: Das Klassenzimmer, die Avatare und das Verhalten der virtuellen Schüler.
Streber oder Klassenclown

Sehen Sie mit einem Klick auf "Aufmerksam/Außer Kontrolle" wie sich die virtuellen Schüler verhalten.
Die Universität der ZukunftHochschule 4.0
Für Studierende bedeutet Digitalisierung nicht nur digitales Lernen und die Auseinandersetzung mit neuen Technologien in ihrem Studienfeld. Auch das Lernen selbst verändert sich – über Techniken wie E-Learning hinaus.
Für Prof. Dr. Phuoc Tran-Gia, Vizepräsident der Universität Würzburg, hat die Digitalisierung für Hochschulen viele Facetten:
Neue WegeDigitalisierung an der Hochschule
‘Massive Open Online Courses‘ gehen einen Schritt weiter. Sie bieten Nutzern die Möglichkeit, von überall aus auf Lerninhalte zuzugreifen und sich genau dann mit dem Lehrstoff auseinander zu setzen, wenn man es möchte.
Wie genau mit diesen Veränderungen umgegangen werden soll, ist noch unklar. Werden Bibliotheken überflüssig? Gehen die Studenten dann überhaupt noch in die Uni? Und wie kommt das alles bei den Betroffenen an?
Jan-Phillip Kaiser (20)
"Mit Hilfe von Videoaufzeichnungen der Wirtschaftsinformatik und Logistik Vorlesungen konnte ich mich ideal auf die Klausuren vorbereiten und gezielt Themenschwerpunkte wiederholen."
Simon Hoferer (22)
"Durch interaktive Online-Kurse lernt man auch neue Formen des Wissenstransfers und den Umgang mit dem Lehrstoff kennen. Das alles geschieht bequem von zu Hause."
Moritz Uttscheid (22)
"Die Möglichkeit immer und überall auf seinen Lernstoff zugreifen zu können, macht vieles einfacher. Allerdings war es gerade am Anfang des Studiums noch schwierig, sich zurecht zu finden."
Franziska Mühlich (20)
"Anders als in der Schule geschehen hier alle organisatorischen Dinge, wie Kurs- oder Prüfungsanmeldungen, aber auch Stoffbereitstellungen, online."
Manuela Deingruber (20)
"Es ist immer wieder erfrischend und abwechslungsreich, wenn der Dozent vom Standardschema abweicht und die Studenten in die Vorlesung einbezieht."
Flip Teaching, Flipped Classroom, Inverted Teaching oder auchInverted Classroom
Die Studenten erarbeiten sich außerhalb der Uni und vor der Lehrveranstaltung das nötige Fachwissen, das dann zusammen mit dem Dozenten im Hörsaal angewendet wird. Dieser steht nicht länger nur am Rednerpult, sondern ist zwischen den Reihen bei den Studenten zu finden.
Flipped Classroom: VorteileWissen: Überall aneignen, unter Anleitung anwenden
Neue Aufgaben, neue Rollen?
Birgt der Inverted Classroom für die Lehrenden überhaupt Vorteile?
Prof. Bofinger
Prof. Dr. Peter BofingerDie Zukunft des Geldes
Prof. Dr. Peter Bofinger leitet an der Wirtschaftswissen-schaftlichen Fakultät den Lehrstuhl für VWL, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen. Er forscht zum Europäischen Währungssystem, aber auch zu Themen wie Einkommensverteilung und Agenda 2010. Als einer der fünf Wirtschaftsweisen berät er die Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen.
Lehre bedeutet für ihn nicht nur Vorlesungen halten: Mit seinen „Grundzügen der Volkswirtschaftslehre“ hat er ein Grund-lagenwerk geschaffen, dass Studierenden einen modernen Einstieg in die Ökonomie eröffnet. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen setzt sich Professor Bofinger damit auseinander, wie sich die Lehre nach der Finanzkrise wandeln muss.
Welche Fragen wirft die Digitalisierung also beim Geld auf?
Droht der große Jobverlust?
Doch nicht nur unser Zahlungsverkehr wird sich mit der Digitalisierung ändern. Spannend wird vor allem sein, welche Entwicklungen sie auf dem Arbeitsmarkt anstößt.
Droht Arbeitnehmern der Jobverlust, wenn sich viele Tätigkeiten automatisieren lassen? Was, wenn ein Roboter den Fabrikarbeiter ersetzt?
Alles nur Dystopie? Aufgabe der VWL ist es auch hierzu realitätsnahe Prognosen zu entwerfen.
Tweet it!
Zu seinen Followern zählen neben anderen Ökonomen auch Studierende und Medienschaffende. Lehre und akademischer Diskurs finden immer stärker über soziale Netzwerke statt.
Lehre in der ZukunftFragen stellen via App
So verwischt er die Grenze zwischen Präsenzveranstaltung und digitalem Lernen und Lehren: Große Veranstaltungen werden in mehrere Hörsäle gestreamt, per App oder im Browser können die Studierenden Fragen stellen, selbst wenn Sie die Vorlesung von einem anderen Raum aus mitverfolgen. Professor Bofinger sieht die Fragen in Echtzeit auf seinem Tablet und kann sofort reagieren.
Wie fällt sein Zukunftsausblick aus? Wie sieht eine Vorlesung in 20 Jahren aus?
Prof. Dauth
Prof. Dr. Wolfgang DauthDie Zukunft der Regional- und AußenhandelsforschungKönnen Maschinen VWL?
Dr. Wolfgang Dauth ist Professor für Empirische Regional- und Außenhandelsforschung. Er profitiert in seiner Forschung vom Datenreichtum, den die Digitalisierung bringt. Er untersucht, welchen Einfluss internationaler Handel und technologischer Wandel auf den deutschen Arbeitsmarkt haben. Außerdem setzt er sich mit regionalen Arbeitsmärkten und der Bedeutung des Pendelns auseinander.
Technologien wie Künstliche Intelligenz helfen bei der Analyse von ökonomischen Daten. Professor Dauth über die Angst, dass Künstliche Intelligenz Volkswirte ersetzt:
In früheren Studien wird der Begriff „Pendeln“ häufig als Wegstrecke zwischen zwei unterschiedlichen Gemeinden definiert. So entstehen Ungenauigkeiten – wer eine Stunde ans andere Ende einer Metropole fährt, wäre in der Untersuchung kein Pendler, wer zehn Minuten aus einem Vorort in die große Gemeinde zur Arbeit radelt, hingegen schon. Mit dem Zugriff auf detaillierte Daten berechnet Professor Dauth hingegen metergenau, welche Distanzen Millionen Pendler zurücklegen und kann so genaue Aussagen treffen.
Wenn er dafür neue Methoden einsetzt, profitieren auch die Studierenden: Sie lernen in seinen Veranstaltungen genau die Instrumente kennen, die die Forschung aktuell einsetzt.
Professor Dauth profitiert in seiner Forschung von neuen digitalen Methoden – und weiß aus der Empirie, dass sich auch die Anforderungen an Uni-Absolventen wandeln. Seine Lehre richtet er an diesen neuen Anforderungen aus:
Wie könnte also eine Vorlesung in 20 Jahren aussehen, Professor Dauth?
Prof. Flath
Prof. Dr. Christoph FlathZukunft im Informationsmanagement
Prof. Dr. Christoph Flath leitet den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement. Gemeinsam mit seinem Team forscht er vor allem in drei Gebieten: Industrie, Digitaler Handel und smarte Städte. Die Energiewende und Smarte Energienetze sind damit für Professor Flath genauso Thema wie etwa die Vorhersage von zukünftigen Modetrends auf Basis der Bildanalyse – wo immer mit großen Datenmengen Entscheidungen besser getroffen werden können, sieht sein Lehrstuhl Potential für Projekte.
Professor Flath ist kein Getriebener der Digitalisierung, er gestaltet sie. Gerade in seiner Disziplin liegt die Annahme nahe, dass Hörsäle schon in wenigen Jahren überflüssig werden könnten. Studieninhalte lassen sich schließlich auch digital vermitteln. Löst das Internet die Uni ab?
Im Informationsmanagement und der Wirtschaftsinformatik stellt sich schon heute die Frage: Wie sehen geeignete Prüfungen aus?
Naheliegend wäre es, wenn die Studierenden Aufgaben am Rechner lösen. Aber geht es dann noch gerecht zu?
Neue Prüfungsformate müssen entwickelt werden.
Information und Wissen ist heute nahezu immer und überall verfügbar. Wir brauchen keine Bücher mehr aufschlagen. Es genügt eine Suche im Browser oder gar via Sprachassistenten, wie Siri und Alexa.
Dadurch ändern sich auch die Anforderungen an die Absolventinnen und Absolventen.
Zukunft der LehreDigitale Projekte
Big Data, künstliche Intelligenz – der Lehrstuhl von Professor Flath versucht diese Themen praktisch zu erforschen, zum Beispiel im Rahmen eines Projektes mit dem Fashion-Unternehmen s.Oliver: Im Digital Retail Lab haben sich verschiedene Akteure aus Forschung und Wirtschaft zusammengeschlossen, um den digitalen Mode-Einzelhandeln weiterzuentwickeln. Professor Flath und seine Projektpartner konzentrieren sich dabei auf drei Themengebiete: Sie analysieren Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette, entwickeln Service-Innovationen für das Omni-Channel-Retailing und setzen auf das Internet of Things, um das Modegeschäft der Zukunft zu entwickeln.
Denn fest steht: Praxis bedingt Forschung – und Forschung bedingt auch immer Lehre. Wie also sieht sie aus, die typische Vorlesung in 20 Jahren?
Prof. Pipernik
Prof. Dr. Richard PibernikDie Zukunft der Logistik
Warenströme werden bereits heute nahezu vollständig digital abgebildet und Unternehmen verfügen über immer größere Mengen an Daten über Kunden, ihre Präferenzen und ihr Bestellverhalten. Bessere Prognosen, schlauere und selbstlernende Planungssysteme auf der Basis von „Big Data“ und eine zunehmende Automatisierung von Transport und Lagerhaltung werden die Logistik fundamental verändern.
Prof. Dr. Richard Pibernik leitet den Lehrstuhl für Logistik und Quantitative Methoden in der BWL. Digitale Lösungen spielen nicht nur in seiner Forschung eine Rolle – er setzt konsequent auf E- und Online-Learning.
Standardisiertes Wissen könne man gut in Webinaren vermitteln, meint Pibernik – in der Lehre bleibe so noch mehr Zeit für individuelle Betreuung.
Pibernik versteht sich vor allem auch als Mentor.
Aktuell kooperiert ein studentisches Team zum Beispiel mit va-Q-tec. Das Unternehmen aus Würzburg bietet unter anderem intelligente temperaturkontrollierte Container an, die ins-besondere beim Transport von Medikamenten zum Einsatz kommen. Beim Einsatz dieser „Smart Container“ fallen riesige Datenmengen an, z.B. Profile von Innen- und Außentemperatur während des Transports, Wartzeiten im Zoll, Wartungsdaten. Gepaart mit umfangreichen Daten über die Kunden und ihr Nutzungsverhalten entstehen ganz neue Möglichkeiten für ein globales Containermanagement.
Das konkrete Ziel des Projektes von LTLS und Forschern aus dem Team von Professor Pibernik war die Verbesserung der Personalplanung im zentralen Wareneingang in Hamburg mit Hilfe der Daten zu den Materialbewegungen. Hierbei wurden Machine-Learning-Verfahren eingesetzt, um aus den gegebenen Daten Prognosen oder direkte Entscheidungsvorschläge zu ermitteln. „Machine Learning gibt uns die Möglichkeit, verschiedene potentiell einflussreiche Faktoren miteinzubeziehen, und die Zusammenhänge mit den Materialflüssen aus den vorhandenen Datenmengen zu lernen“, erklärt Pibernik.
Wie aber sieht denn nun die typische Vorlesung in 20 Jahren aus?
Prof. Winkelmann
Prof. Dr. Axel WinkelmannZukunft der Wirtschaftsinformatik
Prof. Dr. Axel Winkelmann leitet an der Universität Würzburg den Lehrstuhl für BWL und Wirtschaftsinformatik. Der Forschungsschwerpunkt des Lehrstuhls liegt insbesondere in der konzeptionellen Gestaltung von betriebswirtschaftlicher Software. Ziel ist es, dynamischen Veränderungen der Real-Welt durch Implementierung und Adaption von betriebs-wirtschaftlichen Informationssystemen gerecht werden zu können, um so das Zusammenspiel von Geschäfts- und IT-Strategien zu verbessern. Neben den Forschungsmethoden des „Design Science Research“ (Modellierung, Prototyping) arbeitet Professor Winkelmann mit empirischen und mathematisch-formalen Forschungsmethoden.
Er sagt: Die Herausforderungen haben sich geändert. Absolventinnen und Absolventen müssten zukünftig breiter aufgestellt sein als noch vor einigen Jahren.
Der Hörsaal der Zukunft
In verschiedenen Veranstaltungen arbeiten Studierende mit der Software des Labors, in Forschungsprojekten hilft es Professor Winkelmann gezielte Analysen innerhalb der verschiedenen Labor-Systeme durchzuführen.
Digitale Lehre heißt auch mehr Raum für Übungen, multimedialere Vorlesungen, Webinare, mehr Interaktion zwischen Dozierenden und Studierenden.
Bedeuten Online-Kurse allerdings auch, dass die Hochschulen bald überflüssig werden?
Podcasts zum Wissenstransfer
Den Podcast moderiert und produziert Professor Winkelmann selbst. Er erzählt aus eigenen Projekten oder interviewt prominente Gesichter aus dem Umfeld der Unternehmens-software. Nutzer können seinen Kanal auf iTunes oder Spotify abonnieren.
Sind Podcasts eine geeignete Plattform für den Wissenstransfer der Zukunft?
Zukunft der Lehre
Gleichzeitig ein Fach, das sich durch Themen wie Big Data, Künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung in einem enormen Wandel befindet.
Wie sieht die Lehre in 20 Jahren also konkret aus?
Berufe
BerufsporträtsBerufe im Wandel

Fahrlehrer
Fahrlehrer„Halten heißt Schalten“von Manuel Hollenweger
Der Beruf, der vom Zwischenmenschlichen lebt, muss sich wandeln.
„Ich bin in diese Schiene reingedrückt worden und per Zufall noch mit reingeflutscht“, bringt der gebürtige Würzburger seine Laufbahn locker auf den Punkt. Die begann mit 17 bei der Bundeswehr. „Irgendwann hatte ich aber keine Lust mehr im Wald zu liegen und Soldat zu spielen“, erzählt Ramackers. Durch Zufall kam er zur Bundeswehr-Fahrschule, wo er den Beruf lieben lernte. Nach zwölf Jahren Bundeswehr und einer anstehenden Versetzung nach Bremen war dann Schluss – auch seiner Familie zuliebe. Stattdessen zog es ihn nach Euerfeld, ein 500-Seelen-Nest nahe Dettelbach: „Ich bin ein absolutes Dorfkind und fühle mich nur dort wohl.“ Dem Fahrlehrerberuf blieb er auch nach seiner Bundeswehrzeit treu, die Selbstständigkeit stets im Auge. 2014 war es dann soweit: Ramackers übernahm die Fahrschule Witzke. Nur drei Jahre später wurde mit der nächsten Übernahme daraus die Fahrschule Kwiotek-Witzke.
Bei ungeduldigen Eltern wird sein Ton dagegen schärfer: „Manche üben Druck auf ihr Kind aus, weil es zu teuer wird. Dass es um die Sicherheit ihres Kindes geht – das sehen sie dann nicht.“ Ramackers weiß von seiner Zeit bei der Bundeswehr-Fahrschule selbst, wie schnell man unter Druck verkrampft: „Da wurde oft gleich herumgebrüllt. Ich hatte richtige Angst vor den Fahrstunden, obwohl ich alles beherrschte. Da habe ich mir geschworen, nie so zu werden.“ Diesem Credo folgt er bis heute. Obwohl der Arbeitsmarkt nicht viel Nachwuchs bringt, achtet Ramackers sehr auf die Auswahl seiner Angestellten: „Ich möchte emotionale Fahrlehrer, die auf die Leute eingehen. Solche, die das Beste für den Fahrschüler wollen und auch herzlich sind.“ Einen guten Fahrlehrer zeichne vor allem das Einfühlvermögen aus. „Er muss die Schwächen schnell aufstöbern und genau dort ansetzen. In den Kopf des Fahrschülers kann ich zwar nicht reinschauen, aber ich erkenne Ängste am Verhalten.“
Wo der Blick jedoch für gewöhnlich auf die Straße geht, schaut man hier auf drei Bildschirme. „Bremse, drück die Kupplung und starte den Motor“, bittet eine sanfte Männerstimme. Der Motor springt mit einem leisen Brummen an. Die Fahrt geht los – durch die virtuelle Altstadt, links und rechts parkende Autos und pixelige Fachwerkhäuser. „Du fährst zu weit rechts – und wo war der Blinker?“, mahnt die Stimme. Eine Kamera über dem mittleren Bildschirm prüft den Schulterblick. „Vergiss das Hochschalten nicht!“, tönt die nächste Warnung.
Dem autonomen Fahren steht der Fahrlehrer skeptischer gegenüber, sieht aber auch neue Möglichkeiten für seinen Beruf: „Der Mensch muss trotzdem wissen, wie er im Notfall eingreift. Dazu braucht es Schulungen und Prüfungen.“ Bis es soweit sei, wird es in Deutschland aber noch ewig dauern, ist sich Ramackers sicher.
Nach wenigen Minuten hat sie es bis vor die eigene Haustür geschafft. Ramackers lobt ihre ruhige Fahrweise, spricht ihr Mut zu; und zückt sein Smartphone. Marina darf auf dem Display für die Fahrstunde unterschreiben. Auch das geht inzwischen digital: „Die Sprache der Jugend ist nun einmal digital. Also müssen wir uns mit verändern.“
Journalist
JournalistDie Marke Madernervon Karsten Fehr
bike und business heißt Maderners Berufung. Seit mittlerweile fünfzehn Jahren schreibt er beim Würzburger Fachmedienhaus Vogel Communications Group als Chefredakteur für das reichweitenstärkste Fachmagazin der Zweiradbranche. Seinen mehr als 10 000 Lesern berichtet Maderner regelmäßig über neue Motorräder und darüber, wie die Digitalisierung den Zweiradhandel verändert. Bis zu 12 000 Kilometer pro Jahr verbringt der Fachjournalist im Sattel von Motorrädern, 600 verschiedene Modelle hat er bereits unter dem Hintern gehabt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, auch für ihn persönlich: Auf der Titelseite seines Magazins, das sechsmal im Jahr erscheint, prangt ein Logo, die Zeichnung eines Mannes mit kantigen Gesichtszügen, kurzen Haaren und Motorradjacke – es ist er selbst, die Marke Maderner, Mister Motorrad, wie ihn seine Kollegen bisweilen nennen.
Doch so umständlich die Arbeit damals war – Maderner merkte schnell: Der Journalismus ist sein Ding. Das Schreiben, der kreative Umgang mit der deutschen Sprache und der ständige Kontakt zu den unterschiedlichsten Personen hätten ihm schon immer Spaß gemacht, erzählt er. So absolvierte er nach dem Abitur ein Volontariat beim E. Albrecht Verlag in Gräfelfing bei München und arbeitete dort anschließend einige Jahre als Jungredakteur. 1987, im Alter von 23, entschied sich Maderner, an der Isar Politikwissenschaft mit Schwerpunkt VWL zu studieren. Als er Anfang der 90er-Jahre damit fertig war, folgte die Blütezeit des Journalismus: Maderner erhielt zunächst eine Stelle als Wirtschaftsredakteur beim Rheinischen Merkur in Bonn. 1995 wechselte er zum Deutschen Fachverlag nach Frankfurt, wo er für die TextilWirtschaft schrieb und zum stellvertretenden Ressortleiter aufstieg.
15 Jahre später. In einem beschaulichen Wohngebiet im hessischen Nauheim befindet sich das Motorradhaus Stocksiefen, ein idyllisch anmutendes Grundstück, an dessen Eingang ein graues Schild mit einem roten Yamaha-Schriftzug hängt. Ein mit grauen Steinen bepflasteter Weg führt in einen Hinterhof, in dem es von Motorrädern nur so wimmelt. Mittendrin im Zweiradensemble thront der Einzylinder-Motor der Royal Enfield Himalayan – jene mattschwarze Maschine, die Stephan Maderner später testen wird. Es riecht nach Frühling, die Vögel zwitschern, und der Tacho, die Scheinwerfer, ja fast das ganze Motorrad ist von gelbem Blütenstaub überzogen. Maderner zückt sein schwarzes iPhone, lächelt gekonnt in die Kamera und drückt ab. „Danke an Yamaha Stocksiefen“, wird wenige Minuten später auf Facebook zu lesen sein.
Es ist ein ganz bestimmtes Bild, das von ihm gezeichnet werden soll: Die Marke Maderner, eine Gallionsfigur in der Motorradbranche, die es versteht, neue Wege zu gehen. „Ich bin keiner, der unbedingt im Rampenlicht stehen muss“, sagt Maderner über sich selbst, und trotzdem tut er es ständig, weil er weiß, dass es sein Job inzwischen von ihm verlangt. Und weil ihm das Image vom modernen, erfolgreichen Reporter insgeheim doch ganz gut gefällt. Schwächen? Die zeigt er nicht, und wenn, dann klingen sie so: „Manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig, wenn ich merke, dass andere mit meinem journalistischen Tempo nicht Schritt halten können.“
Der Chefredakteur ist sich sicher: „Wir stehen erst am Anfang eines gewaltigen Umbruchs, im Zuge dessen alles digitalisiert werden wird, was digitalisiert werden kann.“ Im Journalismus werde es viele neue Formate geben, deshalb seien Flexibilität und lebenslanges Lernen enorm wichtig. Dass sein Beruf irgendwann von Robotern erledigt wird, wie es in Sportredaktionen schon jetzt ansatzweise der Fall ist, glaubt Maderner aber nicht: „Wie willst du einen Händler mit einer Maschine porträtieren?“, fragt er und liefert die Antwort gleich mit: Dafür brauche es einen Menschen, der vor Ort sei, der Stimmungen aufsauge, dem Händler in die Augen schaue und das Besondere herausarbeite. Journalismus werde deshalb in gewisser Weise immer auch ein Handwerk bleiben.
Taxifahrer
TaxifahrermyTaxi und Uber sind eine unfaire Konkurrenzvon Sarah Heuser
Digitalisierung und was sie für seine Arbeit bedeutet.
Obert schlängelt sein Taxi bereits seit 1990 an Festung und Residenz vorbei, zum Uniklinikum oder auch mal nach München. Vier Jahre später wurde er Unternehmer. Mittlerweile führt er vier Firmen und beschäftigt sieben Fahrer und Taxis. Den guten Fahrern biete er an, gemeinsam ein Taxi zu betreiben. „Ein guter Fahrer ist fleißig, ehrlich, freundlich und fährt vorsichtig“, sagt Obert. Dass dazu auch trotz der Digitalisierung noch die Ortskunde dazugehört, ist für ihn selbstverständlich: „Das Navigationsgerät sucht nach der schnellsten Strecke, wir fahren die kürzeste.“
myTaxi arbeitet aber mit konzessionierten Taxifahrern zusammen, das kalifornische Unternehmen Uber hingegen baute sein Geschäft ursprünglich mit Privatpersonen auf. Erst nach verlorenen Rechtsstreits greift Uber auf Fahrer mit Personenbeförderungsscheine zurück. Beide Dienste leben von einem großen Faktor, der auch vor der Taxibranche nicht Halt macht: Digitalisierung. „Die Digitalisierung wird uns wegfegen“, sagt Obert pessimistisch. Und weiter: „Jede industrielle Revolution bringt neue Arbeitsplätze und ganze Berufe fallen weg.“ Dass er dabei auch seinen eigenen Beruf in Gefahr sieht, erkennt man in seinen dunklen Augen.
Schon seit einigen Jahren werden die Taxis nicht mehr manuell auf die Fahrgäste aufgeteilt, sondern von einem Computer. Die Taxizentrale ist Dreh- und Angelpunkt in Oberts Beruf. Von hier aus wird gesteuert, wo er als nächstes hinmuss. Trotzdem: „Die Hälfte der Zeit stehe ich am Standplatz.“ In der Zeit sind sein Tablet und sein eReader seine Begleiter, um die Wartezeit mit einer Serie auf Netflix oder einer Fußballübertragung zu überbrücken. Vor ein paar Jahren hätte ein schweres Buch herhalten müssen.
Seitdem fährt er meist sieben Tage pro Woche in seinem Taxi Gäste umher und hat regelmäßig schöne Erlebnisse. „Sonst hätte ich es nicht so lange ausgehalten“, sagt Obert. Einmal wurde er für Dreharbeiten gebucht, um Carl Dall vom Würzburger Bahnhof bis zum Main zu fahren, erzählt er. Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: „Eigentlich sind es die Kleinigkeiten, die mir Freude bereiten. Dass die Leute es anerkennen, dass man sich die Nacht um die Ohren schlägt.“ Doch auch die Arbeitsbedingungen findet Obert gut: „Ich bin mein eigener Chef, kann mein Ding machen und mir auch mal einen Arzttermin in den Arbeitstag schieben.“
Anwalt
RechtsanwaltIm Kern zählt immer noch der MenschVon Christoph Daniel
Der Rechtsanwalt für IT- und Medienrecht bewegt sich in einem digitalisierten Arbeitsumfeld. Den persönlichen Kontakt ersetze das aber nicht: „Es geht nur über eine gemeinsame Vertrauensbasis.“ Digitale Zeiten hin oder her.
Loos beschäftigte sich früh mit den Möglichkeiten, die der technische Fortschritt bietet. Er spricht voller Faszination über den Commodore C128, der Computer seiner Jugend. Für ein Informatikstudium sei er aber nicht „Nerd“ genug gewesen. Also Jura: „Ich war schon als Kind ein Gerechtigkeitsfanatiker.“
Und Holger Loos? Er kümmerte sich schon während des Studiums an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg um den Internetauftritt der Jura-Fachschaft. 1997 beantragte er als einer der ersten Studenten einen E-Mail-Account. Loos wollte all das Neue kennenlernen, jede Information aufsaugen.
Loos legte sich schon während des Referendariats eine eigene Webseite an. „Die sah für heutige Verhältnisse noch schrecklich aus“, schmunzelt er. 13 Jahre später ist sein Internetauftritt auf der Höhe der Zeit: Ein 360-Grad-Video führt durch seine Kanzlei. Außerdem bloggt der gebürtige Ansbacher zu aktuellen juristischen Fragen und nutzt das digitale Erzählformat Storytelling, um sich und seinen Werdegang zu präsentieren.
Holger Loos jongliert mit technischen Details, die er in seinen Alltag einbettet. Er könne sich vorstellen, einen Legal Chat Bot zu programmieren – also einen Algorithmus, der Mandanten im Stile eines Messengers selbstständig in einfachen Rechtsfragen berät. Die Verwaltung der Kanzlei ist vollständig digitalisiert. Mit Hilfe optischer Texterkennung werden dort Schriftsätze analysiert.
Loos war sich der Bedeutung des Themas bewusst, lange bevor die Europäische Union die Datenschutz-Grundverordnung verabschiedete. Ein Gespür, das sich gelohnt hat: Der Umsatz der SiDIT GmbH hat sich in den ersten Monaten dieses Jahres im Vergleich zu 2017 versechsfacht.
Fotografin
FotografinWie man die Zeit konserviertvon Katharina Bormann
Ein Schritt durch den Türbogen und man erkennt: Nicht nur auf ihren Bilder konserviert Mark die Zeit. Auch in ihrem Fotostudio in der Ochsenfurter Innenstadt scheinen die Uhren stehen geblieben zu sein: Analoge Kameras aus allen Epochen, Mobiliar aus den 60er-Jahren. Man fühlt sich wie in einem gemütlichen Wohnzimmer. Und das ganz bewusst, erklärt Mark: „Diese modernen Hochglanz-Fotostudios haben ja gar keine Persönlichkeit mehr! Da sieht ja eins aus wie das andere.“ Ihr Studio fällt auf jeden Fall nicht in die Kategorie 08/15: Schaut man genauer hin entdeckt man zwischen Super8-Geräten und Diaprojektoren auch Festplatten, DVD-Player und digitale Spiegelreflexkameras.
Auch für sie hat sich nie die Frage gestellt, einen anderen Beruf als den des Fotografen zu erlernen: „Ich bin im Studio großgeworden und wollte von klein auf in die Fußstapfen meines Vaters treten“. Ihre Augen strahlen, als sie von ihrem Leben berichtet und man spürt die Leidenschaft, die in ihr brennt: Bereits mit acht Jahren hilft sie im Laden aus, mit 17 beginnt sie ihre Ausbildung zur Fotografin und mit gerade einmal 22 Jahren ist sie eine der jüngsten Fotografie-Meisterinnen in Deutschland und übernimmt das Studio.
Über zu wenig Arbeit konnte sich Mark nie beschweren. Die Terminkalender sind voll, die Tage verplant. Teilweise kommen am Wochenende bis zu 5 Brautpaare in ihr Studio. Doch dann hält in den 90er Jahren die Digitalfotografie Einzug in die Branche – und bringt einschneidende Veränderungen mit sich. „Digitale Kameras wurden auch für Privatpersonen erschwinglich und unsere Dienste seltener benötigt“, berichtet Mark. Auch das Ansehen ihres Berufs nimmt ab. Ein wenig Wehmut liegt in ihrer Stimme, als sie berichtet: „Früher hieß es ‚Oh, du bist Fotografin? Toll!‘. Heute gibt es Situationen in denen mir Leute bei Veranstaltungen Sätze wie ‚Was du kannst, kann ich schon lange‘ an den Kopf werfen. Viele meinen, dass es genügt zu wissen wo der Auslöser ist, um sich Fotograf zu nennen“.
Wohl auch, weil sich Mark von Anfang auf die digitalen Veränderungen eingelassen hat. Und das ohne dabei das traditionelle Handwerk aus dem Auge zu verlieren. Viele ihrer Kollegen halten die Digitalfotografie Mitte der 90er nur für einen Trend. Nicht so Mark: „Ich war damals eine der ersten Fotografinnen in Unterfranken, die sich mit digitalen Bildrestaurierungen und Fotomontagen auseinandergesetzt hat“.
Gleichzeitig beobachtet Mark in den letzten Jahren aber auch wieder einen Trend hin zur analogen Fotografie: „Viele junge Leute kommen wieder zu mir und möchten Filme kaufen. Sie interessieren sich wieder mehr für die analoge Fotografie und experimentieren mit den Kameras der Eltern und Großeltern. Das ist toll“, freut sich Mark.
Das Studio vorzeitig zu schließen, ist für sie aber keine Option: „So lange ich dazu in der Lage bin, werde ich geöffnet lassen“. Wird sie dabei so alt wie ihre Eltern, stehen die Chancen gut, dass Renate Mark die besonderen Momente ihrer Kunden auch noch in 20 Jahren konservieren wird.
Apotheker
Apotheker“Kann Doc Morris sowas auch?”von Silke Albrecht
„Ich bin der Meinung, dass Versandhandel asozial ist“, sagt Unger. Asozial im Gegensatz zum „sozialen“ Kontakt mit dem Kunden in der Apotheke. Gerade diese Interaktion und den Leuten im persönlichen Gespräch helfen zu können, sei das Schönste an seinem Beruf. Außerdem ein großer Wettbewerbsvorteil der niedergelassenen Apotheken.
Sein Alter sieht man dem 50-jährigen lediglich an den ergrauten Bartstoppeln an. Das braune, kurzgeschnittene Haar ist nur an den Schläfen grau meliert. Ansonsten ist der passionierte Radfahrer jung geblieben. Schlank, schon fast hager, wirkt er in dem Bordeaux-roten Poloshirt und Turnschuhen. „Apothekerkittel haben wir nicht“, schmunzelt er. Unger wohnt und arbeitet in Dettelbach im Landkreis Kitzingen. Er ist hier aufgewachsen. Seine Mutter und davor sein Großvater haben die Dettelbacher fast 70 Jahre lang mit Arzneien versorgt. Trotz der einschlägigen Familiengeschichte, entschied er sich erst mit 18, mangels besserer Ideen, für die Laufbahn als Apotheker. Nach der Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA) und Studium in Würzburg, zog es ihn in die Ferne. „Mir war klar, dass ich noch genug Zeit in Dettelbach verbringen werde, darum habe ich mit dem Zirkel in die Landkarte gestochen, einen 200 Kilometer großen Radius gezogen und mir eine Stelle außerhalb dieses Kreises gesucht.“ Am Ende landete er in Tiengen. Eine Stadt, nicht viel größer als Dettelbach, aber eben 300 Kilometer entfernt und so schön, dass er fast hätte dableiben mögen. Aber zuhause wartete die heimatliche Apotheke auf ihren Nachfolger.
Außerdem werde, wie überall, auch der Arbeitsalltag in der Apotheke immer digitaler, sagt Unger. Das habe seine guten und schlechten Seiten. „Schwachsinn“ seien beispielsweise einige Auflagen, die mit der kürzlich eingeführten Datenschutzgrundverordnung zusammenhängen. Bei diesem Thema wird Ungers Stimme eindringlich und man hört die Frustration deutlich heraus. „Die Einverständniserklärung ist drei Seiten lang, das liest sich niemand durch und die Kunden sind genervt.“ Den Frust zu spüren bekommt die Wurzel allen Übels. In der Computertastatur zeugt eine Delle von der Wut ihres Besitzers.
Für Bernward Unger und viele Kollegen stehe bei all der Technik, immer der Kunde im Vordergrund. „Natürlich gibt es Leute, die immer das Neuste haben wollen. Aber für die meisten Kollegen, die sich als Heilberufler sehen und sich verantwortlich für die Gesundheit der Leute fühlen, ist das alles nur Mittel zum Zweck. Digital oder nicht. Das Drängen nach Digitalisierung kommt meistens von außen“, sagt er.
Der Chef nutzt das Chefsein auch mal, um sich am Vormittag eine Stunde frei zunehmen und radeln zu gehen. Neben Tischtennis und der Familie, ist Radfahren sein Ausgleich zur Arbeit. 1000 Kilometer schaffe er mitunter von März bis September. Das Fahrrad sei sogar als Dienstfahrzeug angemeldet, weil er Medikamente damit ausliefere.
Bankangestellter
BankberaterKundennähe neu definierenvon Alisa Wienand
Bald sollen nahezu alle Abläufe übers Online-Banking abgehandelt werden. Kontoauszüge landen dann beispielsweise im elektronischen Postfach. So können Drucker und Papier für Kontoauszüge eingespart werden. Finanzplaner Spiegel hat zu seiner Anfangszeit Kontoauszüge noch mit der Hand sortiert. Auch der Ablauf einer Überweisung hat sich geändert. „Überweisungen haben damals sieben oder acht Tage gedauert“, erinnert sich Spiegel. Das ist heute unvorstellbar. Instant Payment sorgt mittlerweile dafür, dass eine Überweisung binnen Sekunden abgewickelt wird.
„Mittlerweile muss man fast IT-Fachmann sein“, urteilt der 46-Jährige aus Sickershausen über die neuen Anforderungen, die an ihn und seine Kollegen gestellt werden. „Das ist nun mal so.“ Spiegel zuckt mit den Schultern und grinst. Lachfältchen spiegeln die lustige Art des Finanzplaners wider. Er trägt ein langes weißes Hemd, eine blaue Krawatte und eine randlose Brille. Sein Job habe sich nicht grundlegend geändert, aber die Umstände: weniger Filialen, weniger Personal, digitalisierte Prozesse. Nach wie vor berät Spiegel Kunden. Die meisten kommen zu einem persönlichen Gespräch in sein Büro. Die Kundenbeziehung steht für ihn und die VR Bank Kitzingen im Vordergrund – trotz digitalem Wandel.
„Mittlerweile muss man fast IT-Fachmann sein“, urteilt der 46-Jährige aus Sickershausen über die neuen Anforderungen, die an ihn und seine Kollegen gestellt werden. „Das ist nun mal so.“ Spiegel zuckt mit den Schultern und grinst. Lachfältchen spiegeln die lustige Art des Finanzplaners wider. Er trägt ein langes weißes Hemd, eine blaue Krawatte und eine randlose Brille. Sein Job habe sich nicht grundlegend geändert, aber die Umstände: weniger Filialen, weniger Personal, digitalisierte Prozesse. Nach wie vor berät Spiegel Kunden. Die meisten kommen zu einem persönlichen Gespräch in sein Büro. Die Kundenbeziehung steht für ihn und die VR Bank Kitzingen im Vordergrund – trotz digitalem Wandel.
Diese Notwendigkeit sieht auch der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Neben dem persönlichen Kundengespräch bauen die Volks- und Raiffeisenbanken die digitalen Zugangswege zur Bank aus. „Wir müssen Kundennähe neu definieren, denn auch die Bank in der Hosentasche kann Nähe bedeuten“, schildert der Verbandssprecher Steffen Steudel. Eine Beratung über Videochat zum Beispiel hat sich in der VR Bank Kitzingen noch nicht etabliert. Allerdings seien Videochats bei anderen Banken bereits im Einsatz, sagt Steudel. Ihre Zahl werde weiter steigen.
Dass sich das Berufsbild des Bankberaters auch in Zukunft wandeln wird, weiß Verbandssprecher Steudel. Künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Automatisierung würden den Beruf weiter verändern. Daran müssen sich Berater immer aufs Neue anpassen. „Veränderungskompetenz ist und bleibt ein wichtiger Erfolgsfaktor“, meint Steudel.
Das ist Spiegel klar: „Mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss mich gemeinsam mit meinen Kunden verändern.“ Dazu gehört auch, sich der neuen Konkurrenz zu stellen, die durch die Digitalisierung entstanden ist: Fintechs, Direktbanken, Robo-Advisors. Spiegel spekuliert, dass sich diese Themen in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiter etablieren werden. „Die Frage ist, ob der Otto-Normal-Verbraucher sowas benötigt“, sagt Spiegel und bleibt zuversichtlich: „Ganz ersetzt werden können wir Bankberater letztendlich nicht.“
Paketzusteller
PaketzustellerZuverlässig zugestelltvon Regina Schmidt
Geschwindigkeit gehört für Stefan Harloff, Paketzusteller bei DPD, zum Arbeitsalltag. „Ich mach mein Ding. Ich habe meine Scheuklappen auf.“ Er will keine Zeit verlieren. Im nächsten Moment begutachtet, scannt und packt er schon das nächste Paket auf seinen Karren. Den Blick hat er oft gesenkt und konzentriert auf seinen Scanner gerichtet. Er trägt eine unauffällige Brille und silberne Ohrringe. Falten auf der Stirn verraten eine ernste Miene, die er aber durch ein Lächeln wieder wettmacht. Harloff trägt kurzgeschorene, dunkelblonde, leicht ergraute Haaren und einen Vollbart.
Online-Handel boomt in Deutschland. 2,5 Milliarden Pakete verschickten die Deutschen 2016 laut der Bundesnetzagentur – vor fünf Jahren waren es noch 700 Millionen weniger. Paketzusteller wie Stefan Harloff bekommen diesen Wandel zu spüren. „Die Zahl der Kundenkontakte ist größer geworden. Früher hatte ich bis zu 80 meist gewerbliche Kunden. Heute sind es 120, darunter auch viele Privatempfänger.“
Rotes T-Shirt, schwarze Hose, auf der linken Seite eine Tasche. Dort befindet sich der Scanner – der digitale Begleiter aller DPD-Zusteller und Zugriff auf das hauseigene IT-System. Ein auf Erfahrungsdaten basiertes Analytics-Modell nimmt jedes Paket auf. Nach dem Beladen wertet es diese aus – heute stehen 109 auf Harloffs Anzeige. Die Datenanalyse bestimmt Zustellungstour und Zeitplan. Für jedes Paket werden zwei Minuten Zeit einberechnet.
Der kalkulierte Zeitpunkt der Zustellung liegt in einem Zeitfenster: 30 Minuten vor und nach der geschätzten Lieferzeit. Diese verkürzt sich im Laufe des Tages um die Hälfte der Zeit. Empfänger erhalten eine E-Mail, in der steht, dass ihr Paket innerhalb dieser Stunde ausgeliefert wird.
Empfänger haben die Möglichkeit ihren Lieferstatus in der „DPD Navigator“-App einzusehen. Außerdem können sie eine Lieferzeit festlegen, einen Abstellort zu wählen oder einen Nachbarn bestimmen. Für seine Kundenorientierung wurde der App im April dieses Jahres vom Bundesverband Digitale Wirtschaft der Deutschen Digital Award in Bronze verliehen. Außerdem gab es im selben Monat eine weitere Auszeichnung, dessen Ausrichter unter anderem das Handelsblatt ist. Seit Einführung der App im Jahr 2017 sei die Quote der angenommenen Pakete laut DPD-Pressesprecher Peter Rey gestiegen. Vielleicht liegt es an der Live-Verfolgung der Zustellungstour?
Das Feature, das beim Kunden die Vorfreude steigen lässt, ist eine unterbewusste Kontrolle für den Zusteller. „Mich persönlich setzt das unter Druck. Ich muss pünktlich sein“, befindet Paketzusteller Stefan Harloff. Er sitzt im Auto und sein Telefon klingelt. Er nimmt ein Gespräch der DPD-Zentrale mit seiner Apple Watch an. Ein Knopf im Ohr sorgt dafür, dass er nicht zum Hörer greifen muss. Diese technischen Spielereien hat er sich privat für seinen Job zugelegt.
Empfänger haben die Möglichkeit ihren Lieferstatus in der „DPD Navigator“-App einzusehen. Außerdem können sie eine Lieferzeit festlegen, einen Abstellort zu wählen oder einen Nachbarn bestimmen. Für seine Kundenorientierung wurde der App im April dieses Jahres vom Bundesverband Digitale Wirtschaft der Deutschen Digital Award in Bronze verliehen. Außerdem gab es im selben Monat eine weitere Auszeichnung, dessen Ausrichter unter anderem das Handelsblatt ist. Seit Einführung der App im Jahr 2017 sei die Quote der angenommenen Pakete laut DPD-Pressesprecher Peter Rey gestiegen. Vielleicht liegt es an der Live-Verfolgung der Zustellungstour?
Das Feature, das beim Kunden die Vorfreude steigen lässt, ist eine unterbewusste Kontrolle für den Zusteller. „Mich persönlich setzt das unter Druck. Ich muss pünktlich sein“, befindet Paketzusteller Stefan Harloff. Er sitzt im Auto und sein Telefon klingelt. Er nimmt ein Gespräch der DPD-Zentrale mit seiner Apple Watch an. Ein Knopf im Ohr sorgt dafür, dass er nicht zum Hörer greifen muss. Diese technischen Spielereien hat er sich privat für seinen Job zugelegt.
Ob Drohnen und Roboter Harloffs Arbeit übernehmen? Da gehen die Meinungen in der Branche auseinander. Antmen, verantwortlich für die Mitgliederbetreuung für Post und Informationslogistik beim DVPT, hält dies für möglich: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 20 Jahren ein Mensch Pakete zustellt“. Bei DPD ist man laut Pressesprecher Rey der Meinung, dass eine standardisierte Zustellung von täglich 2 Millionen Paketen mit Robotern nicht möglich sei. Zukünftig könnte sich das Unternehmen neben bereits etablierten Digital Services Vorteile durch das autonome Fahren versprechen. Paketboten könnten so einer einzigen und wichtigsten Aufgabe ihrer Arbeit nachgehen – dem Zustellen. Dass Roboter zukünftig seine Arbeit erledigen, kann sich Paketzusteller Stefan Harloff nicht vorstellen: „Ersetzen können sie mich nicht. Einer muss zum Kunden“.
Kundenkontakt ist das, was ihn zum Lächeln bringt. Es ist bereits 11 Uhr und die Tour in der Innenstadt ist noch nicht komplett beendet. Doch das schafft er auch sicher, denn seine Zustellungsquote liegt laut IT-System bei 100 Prozent. Stefan Harloff schüttelt den Kopf: „90 Prozent sind bei mir nicht drin“.
Lehrer
LehrerDer Kalkulatorvon Lena Wacker
Lehrer sein ist sein absoluter Traumberuf. Schon als Schüler wusste er, dass er nie etwas anderes werden möchte. Elsesser wuchs in Lohr am Main auf, nur etwa 20 Kilometer von seinem jetzigen Arbeitsplatz in Karlstadt entfernt. Seit fünf Jahren arbeitet er hier als Lehrer am Johann-Schöner-Gymnasium. Sport und Mathe. Seine absolute Traumkombination.
Nach einem ersten Versuch mit Mathe und Physik war für ihn jedoch schnell klar, dass es das nicht war. „Nach einem Jahr konnte ich dann auf Mathe und Sport wechseln. Das war auch definitiv die richtige Entscheidung.“ Elsesser schätzt vor allem die Abwechslung zwischen den beiden Fächern. Zwar fielen bei ihm öfter mal die Pausen flach, weil er mit Umziehen und der Rennerei zwischen Turnhalle und Klassenzimmer beschäftigt sei, trotzdem genieße er den Ausgleich: „Es macht Spaß den Wechsel zu haben zwischen der Position vor der Klasse und dem Unterricht innerhalb der Klasse.“
Eigentlich gibt es nur eines, das dem 32-Jährigen an seinem Beruf keinen Spaß macht: Lange Korrekturen. An richtig harten Tagen steht er von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr vor der Klasse und korrigiert zu Hause noch bis spät am Abend Schulaufgaben. Aber eines gibt er schmunzelnd zu: „Es gibt korrekturaufwändigere Fächer als Mathe und Sport.“
Wie jeder Lehrer hat auch er ein eigenes Tablet zur Verfügung, das er mit einem Beamer im Klassenzimmer verbinden kann. Vor etwa vier Jahren wurden die Geräte an der Schule eingeführt. Für Elsesser wurde das Tablet zum Tafelersatz. Mit Hilfe einer App kann er darauf schreiben, wie auf einer echten Tafel. Handschriftlich auf karierte Kästchen. Nur die Kreide fehlt.
Da die Schüler nach wie vor in ein Heft schreiben, sei für ihn aber das Wichtigste, dass die Struktur am Tablet die gleiche ist: „Es bringt nichts, wenn ich an meinem Tablet ein digitales Feuerwerk loslasse und keiner mehr mit kommt.“ Der Lehrer unterrichtet Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse. Gerade bei den Kleinen sei wichtig, ihnen genau zu zeigen, was sie machen sollen: „Digitalisierung finde ich gut, aber nur da wo sie auch wirklich einen Mehrwert hat.“
Digitalisierung sei für ihn aber sowieso nur dann sinnvoll, wenn alle mitkommen. Sowohl Lehrer als auch Schüler. Aber selbst für ihn gibt es noch Arbeiten, die er lieber auf dem Papier erledigt. Noten zum Beispiel. Da das Tablet im Klassenzimmer immer mit dem Beamer verbunden ist, sei ihm das zu gefährlich. „Schließlich soll nicht die ganze Klasse erfahren, wer welche Note bekommt“, sagt er während er vergeblich nach seinem Geodreieck sucht. „Typisch Mathelehrer“, lacht er über sich selbst.
Allerdings gibt es seit diesem Halbjahr testweise auch eine Tabletklasse an der Schule. Die Schüler einer zehnten Klasse haben während des Unterrichts alle ein Tablet vor sich auf dem Tisch aufgebaut. „Wir sind aber noch weit davon entfernt, für jeden Schüler ein eigenes Tablet anzuschaffen“, lacht er. Denn nicht nur die Anschaffungskosten für die 800 Schüler wären enorm hoch. Nach ein paar Jahren gehen die Tablets auch kaputt. Und jedes neue Tablet koste die Schule 300 Euro, so Elsesser. „Unsere Schule ist aber schon enorm fortschrittlich was den digitalen Wandel angeht“, erklärt er stolz. Das könne man nicht überall erwarten.
Angst davor durch einen Roboter ersetzt zu werden? – das hat Elsesser nicht. Er ist sich sicher, dass er auch in Zukunft noch leibhaftig vor seiner Klasse stehen wird.
IT-Produktmanager
IT-ProduktmanagerArbeitsplatz: Überallvon Franziska Lehnert
Appelmann arbeitet als Produktmanager bei einem Start-Up namens Scoutbee. Das 2015 gegründete Unternehmen ist ein Software-Dienstleister für Einkäufer aus der Industrie. Die zwei Hauptprodukte, eine Lieferantensuchmaschine und eine Plattform zur Kontaktaufnahme mit den Lieferanten, bilden auch das Zentrum von Appelmanns Arbeit. „Ich bin der Ansprechpartner für alle Fragen rund um unsere Produkte“, sagt der 34-Jährige. Er arbeitet zusätzliche Funktionen aus, überlegt, wie sich neue Ideen verwirklichen lassen, betreut Nutzertests oder koordiniert das grafische Design. „Im Endeffekt muss ich alles so aufbereiten, dass die Entwickler es entsprechend umsetzen können.“
„Eigentlich war die Arbeit ähnlich wie gerade mit den ukrainischen Kollegen – nur eben von der anderen Seite aus.“ In Zeiten der Digitalisierung sind Freelancer im IT-Bereich gefragt wie nie. Laut der IT-Freiberufler-Studie 2017 der Fachzeitschrift Computerwoche haben die Selbstständigen für 50 Prozent der deutschen Firmen eine „große bis sehr große Bedeutung“. Auch, weil es an Fachkräften mangelt. Ende 2017 gab es 55.000 offene Stellen für IT-Spezialisten. Das spiegelt sich in den Gehältern wider: Stundensätze von 84 Euro sind der Durchschnitt.
Von Dubai, China, der Schweiz und Thailand aus hat Appelmann schon gearbeitet. Die Insel Phuket hat es ihm besonders angetan. „In Thailand gibt es richtige Hotspots für selbstständige IT-ler“, erzählt er. Typische Touristenziele wie Koh Phangan seien beliebt gewesen, ihm aber zu anstrengend wegen der großen Partyszene.
„Während der Zeit im Ausland war es immer gut, eine Basis zu haben, zu der ich zurückkehren konnte“, beschreibt Appelmann seine Erfahrungen. Sei es nun das Hotelappartement auf Phuket oder die Wohnung in Würzburg – ganz ohne ginge nicht. „Ich hätte nicht alles daheim abbrechen können. Dazu waren mir Familie, Freunde und auch Würzburg zu wichtig.“ Man müsse schon der Typ dafür sein, ständig neue Bekanntenkreise aufzubauen. Ob sonst noch etwas genervt hat? „Es ist ein größerer bürokratischer Aufwand“, sagt er und runzelt die Stirn. Mehr Nachteile fallen ihm spontan nicht ein.
Dass er manche Kollegen nur alle zwei, drei Monate sieht, stört ihn nicht. Im Gegenteil: „Vieles läuft strukturierter ab, wenn man weiß, dass für die Videokonferenz nur zehn Minuten Zeit ist. Anders als vielleicht bei Meetings in großer, persönlicher Runde.“ Außerdem gäbe es trotzdem viel Kontakt, in Summe am Tag etwa zwei Stunden durch Telefonate. So käme das Zwischenmenschliche nicht zu kurz. „Wir haben auch einen Chat, der eher privat ist. Da schickt schon mal jemand einen Witz oder ein lustiges Foto rein“, sagt er und grinst. „Dafür muss man sich wirklich nicht am Schreibtisch gegenüber sitzen.“
Notar
Notar„Da muss erst einmal der Gesetzgeber ran“von Katrin Witte
Er senkt erneut den Kopf und steckt die Nase in das Buch. Dann ein bestätigendes Nicken. Und schon ist die Aufmerksamkeit wieder voll bei seinem Gegenüber. „Die Frage hat sich für mich noch nie gestellt, da das Notariat, in dem ich tätig bin, erst in den 80er Jahren gegründet wurde. Aber nun weiß ich: Es gibt keine Frist. Urkunden müssen wir für immer aufbewahren“, erklärt Adam mit besonnener Stimme.
Doch Rettung naht. Denn schließlich muss man dank E-Book auch die Lieblingsgeschichten seiner Kinder nicht mehr im Wohnzimmerregal aufbewahren. Der Plan: Das elektronische Urkundenarchiv verkleinert die Papierberge. So sollen die Dokumente ab dem Jahr 2022 nicht mehr in den Notariaten, sondern zentral und in digitaler Form bei der Bundesnotarkammer verwahrt werden. Was zuvor beglaubigt wurde, muss jedoch weiterhin in Papierform gelagert werden. Aber immerhin: Die digitalen Dokumente sind dann ihren Pendants in Papierform gleichgestellt und besitzen rechtlich die gleiche Beweiskraft.
Doch dann ging es für Adam erst einmal nach Mellrichstadt. Man könne sich nicht aussuchen, wo man sich als Notar niederlässt, denn die Anzahl der Stellen pro Ort sei von staatlicher Seite genau definiert. Aber er hatte Glück: Und so sitzt Adam heute in seinem Büro in der Eichhornstraße. Doch egal, ob sein Computer in Mellrichstadt oder auf dem großen dunklen Holzschreibtisch in Würzburg steht: Die digitalen Register kann Adam überall nutzen und so Auszüge aus dem Grundbuch oder dem Handelsregister ziehen. Das beschleunige die Erstellung neuer Urkunden enorm und würde die Wartezeiten für die Kunden verringern, so Adam.
Denn auch während der Beurkundung, also während Adam das Dokument vorliest, kämen immer wieder wichtige Fragen bei den Mandanten auf, die es zu klären gilt. „Wenn die Leute zu mir kommen, dann geht es meist um besonders wichtige Entscheidungen wie den Hauskauf oder das Testament. Da sollte nichts schieflaufen“, so Adam.
Die digitalen Verträge sind in der Lage, Transaktionen automatisch auszuführen, wenn die zuvor vereinbarten Bedingungen erfüllt wurden. Doch bis zur Vereinbarung dieser Konditionen ist es ein langer und nicht selten steiniger Weg, bei dem die Eigenheiten jedes einzelnen Falls beachtet werden müssen. Und daher könne nur der Notar die Beratung bis zur fertigen Urkunde leisten, so Adam. Als wolle er dem gesagten Nachdruck verleihen, folgt darauf Schweigen – Eine kleine Pause, die mit ruhiger Stimme flüstert: „Mich wird man auch morgen und übermorgen noch brauchen“.
Und der Notar? Er wartet auf Innovation, angeordnet von ganz oben: „Da muss erst einmal der Gesetzgeber ran“, stellt Adam mit Blick auf Smart Contracts und Co. fest. Gesetzliche Regelungen müssten her – ein rechtliches Fundament für all das. Neben Adam stapelt sich das Papier. Im Regal farblich sortierte Bücher. Auf seinem Computer digitale Akten. „Unser Notariat ist ein Hybrid“, stellt Adam fest. Das Papier sei nicht völlig verschwunden, aber teilweise ersetzt. Doch bis wirkliche Innovation fernab von digitalisiertem Papier Einzug in dem Notariat halten wird, kann es noch dauern. Die Digitalisierung bedroht Adams Beruf nicht und tiefgreifende Änderungen hat sie für ihn auch nicht mit sich gebracht. Doch im Gegensatz zu den alten Urkunden müssen die Arbeitsweisen nicht für immer im Notariat bleiben. Das gilt nicht nur für Adams Büro.
Hotelmanager
HotelmanagerIn keinem Beruf kann man so viel von der Welt sehenvon Nina Härtle
Obwohl die Eltern ihm bei der Berufswahl freie Hand gelassen haben, war er von Anfang an begeistert von der Hotelbranche: „In keinem Beruf kann man so viel von der Welt sehen.“ Und das hat er in die Tat umgesetzt. Nach der Ausbildung zum Hotelkaufmann in Frankfurt arbeitete er zunächst in Paris in der Küche und in Genf im Service. Dadurch spricht er sowohl Englisch als auch Französisch fließend. 1994 hat Unckell den elterlichen Betrieb dann übernommen und ist 20 Jahre später vom Trebing-Lecost Verlag zum Hotelmanager des Jahres ausgezeichnet worden.
Sechs-Tage-Woche ist normal
Im Moment entsteht auf dem Nachbargrundstück ein Neubau mit 54 Hotelzimmern, deshalb ist viel zu tun. Neben dem Vergeben von Aufträgen müssen die Innenarchitektur und die Veranstaltungstechnik geplant werden. Dazu kommt der normale Hotelalltag – E-Mails bearbeiten, Termine wahrnehmen oder die Küche beim Mittagsgeschäft kontrollieren. Etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit verbringt der Hotelier am Schreibtisch. Um elf Uhr findet jeden Morgen ein Meeting mit allen Teamleitern statt, in dem der heutige und der darauffolgende Tag besprochen werden. Nachmittags geht Unckell gerne zum Sport: „Um die Uhrzeit ist es im Fitnessstudio nicht so voll und auch im Hotel ist es ruhiger. Abends gehe ich dann wieder ins Hotel, denn am Abend findet der Großteil des Hotelbetriebes statt und auch in unserem Sternerestaurant KUNO 1408 ist dann am meisten los.“
Neben seiner Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter ist Unckell auch Aufsichtsratsvorsitzender bei der DEHAG Hotel Service AG, der Dachgesellschaft der Best Western Hotels. Einen typischen Arbeitsalltag gibt es für den Hotelmanager deshalb nicht, und selbst ein Routinetag läuft bei ihm anders ab als bei den meisten Menschen. „Ich arbeite in der Regel sechs Tage die Woche und starte meistens zwischen zehn und elf Uhr, denn im Hotel sind die Zeiten einfach anders. Dafür muss ich abends auch länger arbeiten“, erklärt Unckell.
Digitalisierung Optimale Hotelauslastung
Das Hotel arbeitet auch mit Buchungsplattformen wie Expedia, HRS und Booking zusammen. Diese Plattformen werden alle in einem Buchungssystem gebündelt. „Wir bekommen Reservierungen und Stornierungen manchmal gar nicht mit, weil alles über das System läuft. Das gewährt dem Hotel eine sehr hohe Verfügbarkeit“, erklärt Unckell. Wenn beispielsweise ein Zimmer storniert wird, wird es in der nächsten Sekunde für einen anderen Gast direkt wieder verfügbar. Bei der Vielzahl von Angeboten, ist es Aufgabe des Hotelmanagers das Hotel als Marke aufzustellen und einen Mehrwert zu bieten.
Zukunft der Hotelbranche
Als positiven Aspekt der Digitalisierung sieht Unckell die Erleichterung der Prozesse: „Dadurch bleibt für die Mitarbeiter mehr Zeit sich um den Gast zu kümmern. Gerade unser Klientel wünscht viel Beratung an der Rezeption.“ Manche Entwicklungen betrachtet er aber auch kritisch, wie zum Beispiel die Plattform Airbnb, über die Privatleute ihre Wohnung vermieten können: „In Sachen Brandschutz und Entwicklung der Städte übernimmt Airbnb keinerlei Verantwortung. Da werden Vorschriften nicht eingehalten und Airbnb beruft sich darauf, lediglich eine Plattform zu sein“ – das empfindet Unckell als unverhältnismäßig.
Pflegekraft
PflegekraftSchwester Birgitta hat keine Angst vor Roboternvon Svenja Schnüll
Müthering hilft gerne
Planung per Smartphone
Häusliche PflegeEnge Taktung
Doch der Zeitplan ist eng getaktet: Drei Minuten Hautpflege, zehn Minuten Duschen, vier Minuten Anziehen, drei Minuten Medikamente verabreichen. Mit dem Smartphone hakt Mütherig anschließend die erbrachten Leistungen im System ab. Die eingegebenen Daten werden direkt an die Sozialstation der Johanniter weitergeleitet. Das bedeutet auch mehr Verantwortung für die Pfleger: „Was ich im System eingebe, wird dem Kunden später berechnet. Da darf ich mir keine Fehler erlauben“, so Mütherig. Trotzdem überwiegen für die Pflegerin die Vorteile der neuen Technik: „Es ist auf jeden Fall eine Zeitersparnis.“
*Name von der Redaktion geändert
Digitaler Tourenbegleiter
Noch ist aber auch bei den Johannitern nicht alles digital: „Die Informationen für die Krankenkasse dokumentieren wir noch per Hand“, erläutert Mütherig. Doch es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis eine elektronische Übermittlung eingeführt werde. Und auch die Senioren, die sie betreut, werden immer digitaler. Viele von ihnen sind bereits auf E-Mails oder SMS umgestiegen. „Die merken ja auch, dass es praktisch ist, wenn man den Enkeln mal schnell ein Bildchen rüberschicken kann“, sagt Mütherig schmunzelnd.
Zukunft der PflegeRoboter sind nicht emphatisch
Letztendlich stehe bei den Johannitern aber das persönliche Wohl des Kunden im Vordergrund, betont Mütherig. Und das sei oft mit dem Wunsch verbunden, möglichst lange im eigenen zu Hause wohnen zu bleiben. Gleiches gilt auch für Frau Ludwig: „Ich will nicht ins Altersheim“, sagt sie und greift nach Schwester Birgittas Hand. Mütherig lächelt. Sie hat keine Angst, durch einen Roboter ersetzt zu werden.
Unternehmen
UnternehmensporträtsReagieren oder erschaffen?

Schreinerei
SchreinereiAltes Handwerk, neue TechnikVon Silke Albrecht
Frank Ackermanns Betrieb im Landkreis Kitzingen ist auch eine Schreinerei, aber Späne sieht man kaum und die letzte Hobelbank wurde vor ein paar Jahren abgeschafft. In der Werkstatt, wenn man die zwanzig Meter hohen Hallen noch als solche bezeichnen kann, fräst ein Roboterarm einen Block aus Gipsbeton in Form.
Daneben passen zwei Mitarbeiter die Außenverkleidung aus Verbundmaterial an ein Gerüst aus Holz an. Millimeterarbeit. Die Schnittkanten am Holz sind schwarz vom Laser, es riecht verbrannt. Diese Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ist typisch für den Betrieb. Die Digitalisierung verändere den Beruf des Schreiners, sagt Frank Ackermann, doch Fachwissen und handwerkliches Geschick blieben unersetzlich.
Wer würde vermuten, dass inmitten dieser Beschaulichkeit komplizierte architektonische Konstruktionen für die Elbphilharmonie in Hamburg oder den Louvre-Ableger in Abu Dhabi entstehen? „Ich sage immer, schon mein Großvater war international unterwegs, weil er damals in Düsseldorf gearbeitet hat und das war vielen Menschen von hier damals fremder, als es heute Abu Dhabi für uns ist“, sagt Frank Ackermann, Geschäftsführer der Ackermann GmbH in dritter Generation.
Mit der Übernahme durch Sohn Frank und dessen Ehefrau Andrea 1996, hat der Betrieb wieder ein neues Gesicht bekommen. Heute entstehen hier maßgefertigte Konstruktionen aus Holz, aber auch aus Mineralwerkstoffen und Verbundfaser, für Kunden auf der ganzen Welt.
Es wird mittlerweile in vielen Bertrieben verwendet und ist auch Teil der Schreinerausbildung. Basierend auf diesem Verfahren arbeiten in Ackermanns Werkstatt auch zwei Laser, die plattenförmige Werkstoffe millimetergenau zuschneiden und ein Roboterarm, der das Material von allen Seiten aus bearbeiten kann. Dadurch ist der Betrieb so spezialisiert, dass sie Aufträge für große internationale Projekte annehmen können.
Auch Mirko Reich, technischer Berater beim Fachverband Schreinerhandwerk Bayern, sieht die Digitalisierung als große Chance für das Schreinerhandwerk: „Die Ackermann GmbH ist auf dem Gebiet Vorreiter, aber auch andere Betriebe rüsten digital auf. Arbeitsprozesse werden schneller und damit kostengünstiger. Dem Fachkräftemangel, der in der Branche herrscht, können wir so entgegenwirken“, meint der Experte. Also mehr Digitalisierung gleich weniger Arbeitsplätze? Für Ackermann ein klares Nein. „Vor 20 Jahren hatten wir weniger Maschinen und weniger Mitarbeiter. Nur durch die moderne Technik können wir ein breiteres Angebot für unsere Kunden schaffen und bekommen mehr Aufträge, brauchen also mehr Mitarbeiter“, erklärt er.
Er ist gelernter Schreiner, wie die Mehrzahl der Kollegen. Aber wie viele seiner Kollegen hat auch Bart eine Weiterbildung gemacht. Er ist zusätzlich technischer Produktdesigner. „Und Erfinder“ fügt sein Chef mit Stolz in der Stimme hinzu. Bart hat mithilfe bereits bestehender Verfahren ein neuartiges Oberflächenmaterial aus Mineralwerkstoff hergestellt, das jetzt in den Produkten des Unternehmens verarbeitet wird.
„Es fällt nichts weg“, sagt Ackermann „Das Handwerkliche wird schon in der Ausbildung heute nicht mehr so vertiefend behandelt, wie vor 30 Jahren. Dafür sind neue Aufgaben dazu gekommen.“
Weitere Produkte sollen folgen, denn der Geschäftsführer kann langfristig planen: Beide Söhne wollen in den Betrieb einsteigen.
E-Learning-Unternehmen
E-Learning-Unternehmen„Digitalisierung ist eine Generationenfrage“ von Sarah Heuser
Direkt am Berliner Ring sitzen die 50 Mitarbeiter der Multa Medio Informationssysteme AG auf zwei Etagen vor ihren Bildschirmen. Papier findet man nahezu keins auf den Schreibtischen. Nicht verwunderlich in einem Unternehmen, das von der Digitalisierung lebt. Sie passiert bei Multa Medio ganz selbstverständlich. Hier wird nahezu alles am Computer gemacht, außer die Kunden wollen ihre Rechnungen noch per Post. „Wir können nur so digital sein, wie unsere Kunden das sein wollen“, sagt Björn Steinacker, Vorstand von Multa Medio.
Die Plattformen sollen traditionelles Lernen und E-Learning miteinander verbinden. Sich nur auf die Onlineversion zu konzentrieren, mache zurzeit aber noch keinen Sinn, sagt Helmerich. Es sei immer eine Frage des Unternehmens, dessen Mitarbeiter und den Themengebieten. Präsenzunterricht sei daher für einige Kunden noch immer interessant: „Ein Pilot übt schließlich auch am Flugzeug und nicht nur am Simulator.“ Dennoch bieten sich gerade Online- Lernangebote für Unternehmen an, deren Mitarbeiter an verschiedenen Standorten arbeiten.
Die Plattform des Biotech-Unternehmens Qiagen ist laut Helmerich der klassische Fall für einen E-Learning Kunden: „Es werden regelmäßig neue Produkte herausgebracht. Dann müssen möglichst schnell alle Mitarbeiter weltweit darüber informiert und geschult werden.“ Themen wie Arbeitssicherheit, Datenschutz und Arbeitsrecht gehören klassischerweise zu jedem E-Learning. Unter anderem arbeitet Helmerich und sein Team aus etwa zehn Mitarbeitern auch für die Deutsche Bahn und bietet dort eine Lernplattform an. Mitarbeiter in allen Unternehmen wissen: Know-How ist Kapital.
Im Projektgeschäft des Unternehmens ist es die Hauptaufgabe, digitale und nachhaltige Lösungen zu etablieren. „Wir wollen Prozesse optimieren und Zeit, Kosten und Aufwand minimieren“, sagt Steinacker. So sei es beispielweise bei Flugzeugen lange Zeit gang und gäbe gewesen, bei kaputten Sitzen ein Fax zu schicken. Ein QR-Code an den Sitzen erleichtert den Prozess aber nun: So weiß der Zulieferer sofort, dass ein neuer Stuhl benötigt wird.
Alle Prozesse verändern sich durch die Digitalisierung dauernd. Das soll aber nicht vorgegeben, sondern von allen Mitarbeitern mitgestaltet werden: „Wir geben nur die Leitplanken vor, die Verbesserungsvorschläge können alle bringen“, sagt Steinacker. Besonders wichtig dabei sind nachhaltige Lösungen. Dazu gehört nicht nur das papierlose Büro, das nach und nach umgesetzt wird, sondern auch ein energieeffizienter Serverpark im Keller. Doch nicht nur das: „Wir gestalten unsere Softwarelösungen so nachhaltig, dass sie lange halten“, sagt Steinacker. So sind alle Produkte von Multa Medio leicht anpassbar und damit sowohl ökonomisch als auch ökologisch nachhaltig.
Architekturbüro
ArchitekturbüroWenn Bauherren virtuelle Gebäude betretenvon Alisa Wienand
Möglich macht das die vernetzte Planungsmethode Building Information Modeling, kurz BIM. Diese Methode dient den Mayarchitekten aus Würzburg als Arbeitsgrundlage. Das Team aus zehn Mitarbeitern ist damit vielen anderen Architekturbüros voraus. Ergebnisse ihrer vernetzten Planung sind in ganz Deutschland zu sehen: eine Penthouse-Wohnung in Berlin, ein Haus auf Rügen und eine Vinothek in der Münchner Residenz.
Beim Projekt Steinburghotel habe sich bereits herausgestellt, dass die Architekten an dem 3D-Modell intensiv mit Fachplanern zusammenarbeiten müssen. Während das Architekturbüro die übergreifende Planung übernimmt, sind Fachplaner für einen bestimmten Projektabschnitt zuständig. Das Besondere an BIM ist, dass der Zehn-Mann-Betrieb ein 3D-Gebäudemodell entwirft. Auf das können die am Bau beteiligten Firmen wie Elektrotechniker, Haustechniker und Tragwerksplaner, über ihre eigenen Rechner zugreifen. „Bei BIM müssen wir andere Wege gehen, um unser Ziel zu erreichen“, erklärt Hofmann. „Die Architektur selbst ändert sich dadurch nicht.“ Ein Vorteil dabei sei, dass das Architekturbüro Fehler leichter vermeiden könne. Sie sehen alles auf einen Blick, auch die Problemstellen. „Es ist wichtig, dass alle Detailpunkte schon im Voraus geklärt sind“, sagt der 36-Jährige.
Während der vernetzten Planung laufen alle Fäden im Architekturbüro zusammen. „BIM bietet für den Berufsstand die Chance, wieder als Gesamtkoordinator eines Projekts in Aktion zu treten“, sagt Heiner Farwick, Präsident vom Bund Deutscher Architekten. Dadurch würden die Aufgaben in Architekturbüros umfangreicher. „Dieser Aufwand, der allen Beteiligten zugutekommt, muss angemessen honoriert werden“, fordert Farwick.
Von den Veränderungen durch BIM lassen sich viele Architekturbüros abschrecken. Eine Befragung der Bundesarchitektenkammer von April 2018 zeigt, dass nur neun Prozent der deutschen Architektur- und Planungsbüros BIM anwenden. Hofmann vermutet, dass viele die Risiken des vernetzten Arbeitens schlecht abschätzen können und deshalb darauf verzichten. Außerdem sei die Einarbeitung in das Thema sehr zeitintensiv. Trotzdem ist der Architekt überzeugt: „Wenn sich jemand gegen BIM wehrt, hat er verschlafen.“
Mit seinem Smartphone scannt Hofmann einen QR-Code ein. Auf dem Bildschirm erscheint das Esszimmer einer Villa in Waldbrunn. Der Architekt dreht sich mit dem Smartphone um die eigene Achse. Er sieht die Küche und dann die Treppe, die ins nächste Stockwerk führt. Es ist, als würde man sich von einem festgelegten Standpunkt aus in der Villa umsehen. Setzen die Bauherren eine Virtual Reality Brille auf, können sie sogar in der Villa herumlaufen. Dass ihre Kunden das Haus vor der Fertigstellung virtuell betreten können, ist für die Würzburger Architekten Vor- und Nachteil zugleich. Einerseits können sie sich zwar sicher sein, dass den Kunden das Gebäude gefällt. „Aber der Überraschungseffekt fällt komplett weg“, sagt Hofmann. Die Herausforderung liege deshalb darin, die richtige Stufe zum richtigen Zeitpunkt zu präsentieren.
Weingut
WeingutWeinbau mit Gefühlvon Frederic Servatius
Seit 1890 bewirtschaftet das Würzburger „Weingut am Stein“ als Familienunternehmen Weinberge in der Region Mainfranken. Neben ökologischem Weinbau setzt Ludwig Knoll, der das Unternehmen in fünfter Generation führt, auch auf digitale Vernetzung – und verbindet damit zwei Welten, die auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammenpassen wollen.
Für die Arbeit im Weingut hat das konkrete Folgen. So versucht das „Weingut am Stein“ die Monokultur Weinberg durch Pflanzen anzureichern: „Es muss immer irgendwas blühen“, erklärt Knoll. Mehr als 70 verschiedene Kräuter pflanzt der Winzer so in den Weinbergen seines Weinguts an, die wiederum Insekten anziehen und somit helfen Schädlinge fernzuhalten. Auch die Hühner und Schafe sind ein Mittel der Bodenpflege.
Das „Weingut am Stein“ nutzt zudem auch vom bayerischen Landwirtschaftsministerium zur Verfügung gestellte Geodaten. Mit dem Einsatz von Drohnen könnte man künftig auch direkt den Gesundheitszustand eines Weinbergs einschätzen, zumindest soweit kranke Pflanzen von oben sichtbar sind. „Auch zum Versprühen von Pflanzenschutzmitteln wäre der Einsatz von Drohnen denkbar“, meint Knoll. Die Arbeit wäre dann nicht nur digitaler, sondern auch ökologischer: Der Drohneneinsatz ist spritsparender als herkömmliche Methoden, außerdem können die Mittel selbst auch gezielter ausgesprüht werden.
Bei diesem Herangehen orientiert sich Knoll nicht an direkten Vorfahren: „Tatsächlich glaube ich, dass ich eher wieder von der Generation meines Urgroßvaters und Großvaters lerne, als von der Generation zwischendrin. Die Generation vor mir war eine sehr Industriegläubige. Da hat man geglaubt, dass die Natur sich anpassen wird“, so Knoll.
Dafür ging der Winzer auf anderen Pfaden eigene Wege, zum Beispiel beim Weinfest des Weinguts: „Das habe ich nach meinem Gusto gestaltet: Für viele war es fast eine Provokation, das Weinfest mit einem Jazz- oder Rockkonzert zu begleiten.“ Mittlerweile sind die Konzerte vom Weinfest nicht mehr wegzudenken. Wie damals macht Knoll die Musikauswahl auch heute noch selbst. Wenn er von den Musikern spricht, gerät er ins Schwärmen.
Ludwig Knoll selbst sagt, dass sein Unternehmen an der Stelle ein wenig Hexenküche betreibt: „Wir rühren eine kleine Menge im Kuhhorn kompostierten Rindermist in etwa 300 Liter Wasser intensiv ein.“ Das Ganze wird dann auf etwa zehn Hektar verteilt, das eigentliche Produkt ist also extrem verdünnt. Knoll ist der Meinung, dass die damit verbundene Information gerade dann umso stärker wirkt. Im Ergebnis stehen aus seiner Sicht konkrete Erfolge: Spannendere Weine aus vitaleren Reben sowie nachhaltigere Böden.
Eine Gruppe vergisst er dabei: Die Hühner und Schafe, die durch den Weinberg laufen dürfen.
Holzbau
HolzbauDie digitale Renaissance des Holzbausvon Christoph Daniel
„Eigentlich ist es zu schade, um nicht darin zu wohnen“, lächelt der Zimmerermeister, bevor er die Tür mit seinem Smartphone öffnet. Im Innern wird helles Fichtenholz mit grauen, matten Fliesen kombiniert. Ein Teil der Außenfassade ist mit roten Steinwollplatten ummantelt. Holzbau? Das Musterhaus zeigt, dass das Familienunternehmen nicht nur in dieser Branche tätig ist. Es kann mehr.
Die Arbeitsvorbereitung erfolgt heute fast ausschließlich am Computer. „Wir passen jedes Bohrloch, jede Fräsung, die beispielsweise ein Dachstuhl braucht, im 3-D-Modell individuell an“, erklärt Weyer. Daraus entsteht ein Werkplan. Der Computer schickt diesen direkt an die CNC-Maschine, die sich die benötigten Werkzeuge automatisch sucht und die Hölzer millimetergenau zuschneidet. „Das sorgt dafür, dass knapp ein Drittel der Arbeitszeit aus der Werkstatt ins Büro verlagert wurde. Daraus ergeben sich mehr freie Ressourcen für die Montage“, berichtet Weyer. Die digitale Abwicklung ist auch wirtschaftlich spürbar: 2017 erzielte Holzbau Weyer 15 Prozent mehr Umsatz als im vorangegangenen Jahr.
Trotz dieser Neuerungen weiß der Unternehmer auch, dass die Digitalisierung nicht alleine ausschlaggebend für den Erfolg seines Betriebs ist. Man kennt Holzbau Weyer in der Region. Das sei vor allem auf die regionale Verwurzelung und die hervorragende Mundpropaganda zurückzuführen. Dafür gibt es laut dem Firmenchef eine einfache Formel: „Wir versuchen absolut termintreu zu liefern und können deshalb flexibel auf Kundenanfragen reagieren.“ Das Unternehmen hat heute noch Geschäftspartner, die schon mit Weyers‘ Großvater und Urgroßvater zusammenarbeiteten.
Das Holzbauunternehmen profitiert auch von der aktuellen Konjunkturlage und der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Laut dem Bund deutscher Zimmermeister (BDZ) ist die Anzahl der genehmigten Gebäude in Holzbauweise seit Jahren steigend, besonders in Süddeutschland: 2016 waren 20 Prozent der bayerischen Neubauten aus Holz. Für 2017 erwarte man eine weitere Steigerung, so der BDZ.
Deshalb sei es fatal sich nur darauf zu konzentrieren – und hohe Summen in Maschinen zu investieren, die im schlimmsten Fall nur selten in Betrieb wären. Man wolle lieber verschiedene Gewerke bieten: „Langfristig gesehen ist das die beste Variante. Hier kann das Handwerk punkten.“ Stephan Weyer weiß das. Seine Familie ist schon lange im Geschäft.
OfenherstellerWenn Digitalisierung zur wichtigen Backzutat wirdvon Pia Greinacher
„Diese Unternehmen agieren teilweise weltweit, da kommt man um genormte Prozesse, eine zentrale Steuerung und festgelegte Produkte nicht herum.“ Da ist er einer Meinung mit Christoph Weigel, dem Produktmanager. Die Kundenanforderungen haben sich in den vergangenen Jahren wesentlich verändert
Der nationale und internationale Markt für Backtechnik wachse, und das seit Jahren, so Beatrix Fräse vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Dadurch steigt natürlich auch der Wettbewerb. Deshalb setzt Armin Werner, Leiter des Geschäftsbereichs Backstationen, die Messlatte für MIWE hoch. „Immer einen Schritt voraus sein“, so lautet sein Rezept, um die Digitalisierung in das traditionelle Unternehmen zu integrieren.
Aber nicht nur diese Aspekte schaffen Anreiz. Felix Twittmann und Reber Jaafer, ebenfalls Auszubildender, macht es großen Spaß das Schweißen auf diese Art zu üben. Neben dem Schweißsimulator sei das moderne MIWE Ausbildungszentrum – MAZ genannt - das seit 2017 in Betrieb ist, ein Grund, weshalb sich Reber vor knapp einem Jahr für eine Ausbildung bei MIWE entschied. Neben diesen Aspekten unternimmt das Unternehmen noch weitere Schritte, um mit dem Wandel der Branche zu gehen und die Digitalisierung einen Teil des Ganzen werden zu lassen. Digitalisierung bedeutet für MIWE nicht nur Technik, es geht Ihnen viel mehr darum, erst einmal zu beobachten und zu verstehen.
Aufgrund der veränderten Anforderungen müsse man den Fokus darauf setzen, zu erkennen was sich der Kunde wünscht bevor dieser überhaupt selbst davon weiß. Im zweiten Schritt sucht man bestmögliche Lösungen für den entstandenen Bedarf. Was Werner hier auf den Punkt bringt, beschäftigt bei MIWE auch das bereichsübergreifende Geschäftsfeld Digital Solutions, das digitale Lösungen für die Backstube entwickelt.
Während sich der Geschäftsbereich Backstationen allen Prozessen und Abläufen des Backens im Laden widmet, bedient der Bereich Backanlagen Produktionsbackstuben aller Formen und Größen, vom handwerklich organisierten Betrieb bis hin zur industriellen Backwarenproduktion.
Der Innovationsgeist des Unternehmens musste dabei nicht erst geweckt werden, sondern ist dem Unternehmen bereits bei seiner Gründung von Michael Wenz in die Wiege gelegt worden. Seither versucht MIWE kontinuierlich Innovationen, die die Welt des Backens grundlegend verändern, zu entwickeln. Das Ladenbacken, das für uns heute selbstverständlich ist, war eine dieser Innovationen. Es wurde in den 60er Jahren von Edgar Michael Wenz, dem Sohn des Unternehmensgründers, erfunden. Zu jener Zeit wurde er für diese Erfindung noch belächelt – die Entwicklung hat aber gezeigt, dass er damals schon einen Schritt voraus war.
Während im Ausbildungszentrum Nachwuchskräfte das Schweißen also weiterhin fleißig mit Hilfe des Schweißsimulators üben und die Mitarbeiter im Vertrieb, der Entwicklung und im Service immer ein Ohr beim Kunden haben, sollte sich die MIWE Michael Wenz GmbH nicht auf ihrer Innovationsstärke ausruhen, sondern versuchen die Herausforderungen des Wandels weiterhin gemeinsam mit ihren Kunden zu meistern.
Möbelhaus
MöbelhausMöbelhandel im Wandelvon Nina Härtle
Zur Unterstützung wird das Team ab September durch einen neuen Azubi verstärkt. Dieser wird im Unternehmen seine Ausbildung als E-Commerce Kaufmann absolvieren – als erster, denn die Ausbildung startet im Sommer 2018 bundesweit. Darüber freut sich auch Martin Groß-Albenhausen, stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel: „E-Commerce wächst dynamisch in allen Bereichen der Wirtschaft. Mit dem neuen Beruf tragen wir dazu bei, dringend benötigte Fachkräfte für die Digitalisierung zu schaffen.“ Dass Digitalisierung bei den Jugendlichen angesagt ist, zeigt der Zulauf an Bewerbungen. „Für die Stelle zum E-Commerce Kaufmann haben sich viel mehr beworben als für die anderen Ausbildungsberufe“, erklärt Spitzhüttl.
Auch sonst sind immer wieder aufwendige Dekorationselemente, wie etwa eine Mooswand aus Island, im ganzen Haus zu finden. Für diese besondere Atmosphäre arbeitet Spitzhüttl mit dem Designbüro Gruschwitz aus München zusammen. Dieses hat bereits Aufträge für namenhafte Marken wie Adidas, Chanel oder den FC Bayern München umgesetzt.
Die Digitalisierung verändert auch die Möbelbranche. Eine Beispielküche in der Ausstellung zeigt, was technisch heute schon möglich ist: Der Backofen und der Dampfgarer können mit Hilfe von Wifi über das Smartphone gesteuert werden. So lässt sich beispielsweise der Backofen schon einmal vorheizen, bevor man überhaupt das Haus betreten hat. Ein weiteres Merkmal ist die höhenverstellbare Dunstabzugshaube. Außerdem sind in der Küche Musikboxen verbaut, die durch eine Bluetooth-Verbindung gesteuert werden können.
Mittlerweile schaut der Senior allerdings nur noch zwei Tage die Woche vorbei und lässt den Junior im Großen und Ganzen walten. „Wir sind eigentlich schon über den Generationenwechsel hinaus“, meint Sebastian Spitzhüttl. Bevor der Junior in das Unternehmen mit eingestiegen ist, hat er in Köln seinen Betriebswirt mit der Fachrichtung Möbelhandel absolviert. Doch dieser Weg war nicht immer so vorgezeichnet. „Ich wollte damals Profifußballer werden und war gar nicht mal so schlecht. Am Ende lag es dann doch nahe, ins Familienunternehmen einzusteigen, da mir BWL und Zahlen eigentlich ganz gut liegen“, erzählt Spitzhüttl.
Bei der Frage, wo Spitzhüttl das Unternehmen in zehn Jahren sieht, kommt er ins Grübeln und sagt dann: „Ziele können einen auch hemmen, deshalb lebe ich lieber im hier und jetzt und schaue was passiert. Die Welt von heute ist so schnelllebig, dass es schwerfällt, Prognosen zu treffen. Ich war häufig der Erste und bin damit nicht immer gut gefahren, man darf aber auch nicht der Letzte sein“, erklärt Spitzhüttl mit einem Schmunzeln im Gesicht. Er meint, man muss mehr um den Kunden kämpfen als früher. Aus diesem Grund plant das Möbelhaus Spitzhüttl in den nächsten Jahren den Ausbau des Online-Shops und weitere Umbauten mit neuen Elementen wie etwa der Mooswand.
Solarunternehmen
SolarunternehmenDas A-Team der Solarprojektevon Manuel Hollenweger
Ihre globale Projektüberwachung verdankt die Gildemeister energy solutions GmbH auch der Digitalisierung. Das kleine Würzburger Unternehmen aus dem großen DMG Mori Konzern möchte digitale Chancen nutzen und neue Wege gehen.
Gildemeister energy solutions hat sich seit 2004 den erneuerbaren Energien verschrieben. Angeboten werden Servicedienstleistungen für grüne Energie, besonders im Bereich Solar. Die vier Geschäftsbereiche reichen von Planung und Aufbau großer Freiflächen-Solarparks (Utility Scale) bis zur Energieberatung, inklusive eigener Energiemanagement-Software. Das Unternehmen präsentiert sich jung und flexibel. Essentielle Eigenschaften in der Branche, meint Geschäftsführer André Kremer.
Die Würzburger retteten sich nur knapp vor einem ähnlichen Schicksal: Nach dem Einstieg in die Branche ging das Unternehmen 2007 an den spanischen Markt – und wurde übermütig. „Man wollte die Arbeit der Entwickler auch noch übernehmen“, erzählt Kremer. Als man den Fuß 2009 auf den italienischen Markt setzte, kam die Wirtschaftskrise – und mit ihr schwierige Zeiten für Gildemeister energy solutions. Man habe den falschen Leuten vertraut und nicht schnell genug auf den Markteinbruch reagiert, so Kremer heute. Doch Gildemeister konnte sich retten: „Wir haben unsere Lehren aus der Krise gezogen und uns breiter aufgestellt“, erklärt er. Hinzu kam unter anderem die Beratung in Sachen Energieeffizienz.
Auch das Team wurde 2011 umgestellt, Schlüsselpositionen neu besetzt, die Krise überstanden. „Das führte zu einer internen Verbundenheit“, sagt Kremer. Diese scheint bis heute anzuhalten. Etwa 70 Mitarbeiter gibt es am Standort Würzburg, rund 200 im energy solutions Konzern. Von zwanghaften Strukturen seitens des großen Mutterkonzerns DMG Mori ist nichts spürbar. Auch dank eines jungen Teams und entsprechend frischem Arbeitsklima: Der Altersdurchschnitt liege bei Mitte 30, heißt es. E-Ladestationen auf dem kleinen Parkplatz und eine Kaffeelounge mit Barhockern verbreiten einen Hauch von Start-Up Gefühl.
Besonders im Bereich der Freiflächen-Solarparks lösen die Würzburger Probleme. Rund 80 Prozent des Gesamtumsatzes erzielt dieser, im Ausland erwirtschaft man 90 Prozent des Umsatzes. „Im Projektbereich ist man immer so eine Art Nomadenvolk“, schmunzelt Kremer. Ständig wechselnde politische Rahmenbedingungen im Ausland machen langfristige Prognosen jedoch extrem schwierig: „Selbst fünf Jahre in der Welt der Erneuerbaren Energien sind schon eine unglaublich lange Zeit“, erklärt er.
Die Vorteile der Digitalisierung spürt auch Patrik Streng. Er überwacht fertige Solarparks, wie den in Carlino – via Ferndiagnose, vor seinem Bildschirm in Würzburg. Von Leistungsprofilen der Solaranlage, bis Live-Cams zur Beurteilung der Wetterlage: „In den letzten Jahren sind es immer mehr Daten geworden. In der Zwischenzeit kann ich beinahe alles von hier abfragen“, erzählt der 32-jährige. An ein Horrorszenario, in dem künstliche Intelligenz die Arbeit komplett übernimmt, glauben weder Kremer noch Streng. Es werde immer eine persönliche Schnittstelle geben, die mit Kunden und Kollegen kommuniziere, hört man von beiden.
Auch in Würzburg will man mittelfristig maßgeschneiderte Lösungen anbieten: Energie soll als Service verkauft werden, nicht als Produkt aus der Steckdose. Kurzfristig beschäftigt den Servicedienstleister jedoch vor allem der Fachkräftemangel. Und so lautet Kremers Devise auch in Zeiten der Digitalisierung: „Das Einfache geht digital. Doch das richtig Gute, das geht nur mit eigenem Denken!“
Scoutbee
IT-UnternehmenWenn digitale Suchbienen fliegen
Wendet sich nun ein Kunde mit einer Lieferantensuche an die Würzburger, wird Artimis aktiv und durchforstet innerhalb weniger Stunden die Datenbank nach passenden Lösungen. Bis zu 85 Prozent Ressourcen ließen sich dadurch für Firmen einsparen, erzählten die Gründer einmal in einem Interview. Die Jung-Unternehmer wollen damit die Branche revolutionieren – und zur „besten Plattform der Welt werden“, so Heinrich.
Seitdem hat sich einiges getan. Über 30 Mitarbeiter gehören mittlerweile zum Kernteam. Einige davon sitzen im Ausland, in der Ukraine, Litauen, Russland oder im Aserbaidschan. Trotzdem sind die Räume der Gründerwerkstatt auf dem Gelände des Vogel-Fachverlags mittlerweile deutlich zu klein. 15 Schreibtische stehen dort dicht beieinander, Schall- oder Sichtschutz dazwischen gibt es nicht. Auch deshalb sei es in der Planung, noch das Nebengebäude anzumieten. Außerdem sind einige neue Stellen ausgeschrieben. „Wir wollen wachsen“, sagt Heinrich. „Ganz nach dem Motto ‚Gesund, aber schnell‘.“
„Langfristig sind für uns auch andere Branchen interessant“, erklärt Heinrich. „Einfach, weil unser Produkt gut industrieübergreifend anwendbar ist.“ Genauso könnte man für Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Verpackung oder Medizintechnik Lieferanten-Daten erheben. „Wir stehen erst am Anfang.“
Was nach einer Kampfansage an das bisherige System der Lieferantenbeschaffung klingt, wollen die Scoutbee’ler nicht als solche verstehen. Das sei nun einmal der Gang der Dinge. „Vor drei Jahren waren alle unsicher, weil sie nicht wussten, was Digitalisierung bedeutet“, wirft Laura Zwickl ein, die als Projektassistentin bei Scoutbee arbeitet. „Heute gibt es kaum einen, der zögert, sich der digitalen Möglichkeiten zu bedienen.“
„Die Idee von Scoutbee ist deshalb an sich nicht neu, aber die Herangehensweise.“ Eher ungewöhnlich sei deren offenes Prinzip der Listung, normalerweise verspreche die Präsenz auf einer Ausschreibungsplattform schon eine gewisse Exklusivität. „Ich glaube nicht, dass Einkäufer für ihr komplettes Produktportfolio Lieferanten auf diese Art und Weise suchen werden“, schätzt der Experte. Zu wichtig sei die individuelle Gestaltung eines Produkts – und das fange bei der Lieferantenauswahl an.
Damit haben sie die dritte Entwicklungsstufe eines Start-Ups erreicht, die sogenannte Wachstumsphase. Dem Startup-Monitor des Bundesverbands Deutsche Startups zufolge sind aktuell knapp 30 Prozent der Jungunternehmen so weit oder höher entwickelt. „Wo ich Scoutbee in fünf Jahren sehe?“ Gründer Christian Heinrich lacht. „Interessanter wird erst einmal, was im nächsten Jahr passiert.“
Brose
Automobilzuliefer„Den digitalen Wandel können wir nicht aufhalten“von Svenja Schnüll
Früher wurde diese Arbeit von Hand gemacht, erzählt Werkleiter Bernd Kaufer. Vor 30 Jahren lag die Akkordleistung bei 20 gewickelten Motoren pro Tag. Mittlerweile verlassen täglich rund 100.000 Elektromotoren das Werk. „Mit dem Kupferdraht, den wir hier jährlich verarbeiten, könnte man 65 Mal den Globus umrunden“, beschreibt Kaufer.
Trotz des Umsatzes von 6,3 Milliarden Euro im Jahr 2017 wird noch immer viel Wert auf den familiären Zusammenhalt im Unternehmen gelegt. Dafür sorgt Michael Stoschek, der von 1971 bis 2005 Brose als Geschäftsführer leitete. Heute ist er Vorsitzender der Unternehmensgruppe, die in 23 Ländern vertreten ist, und bereitet seine Kinder auf die Übernahme vor.
Begeistert berichtet er von der Technik, die fast jeder nutzt und doch kaum einer je gesehen hat: Die Motoren werden unter anderem als Antriebe für elektrische Lenkungen, Parkbremsen, Klimaanlagen und Fensterheber im ganzen Auto verbaut – allerdings versteckt hinter der Verkleidung. Das Werk in der Ohmstraße ist das größte von acht Brose-Elektromotorenwerken weltweit. Mit rund 1.800 Mitarbeitern gehört der Standort zu den größten Arbeitgebern in Würzburg.
Den entscheidenden Faktor in Sachen Wettbewerbsfähigkeit liefere die Automatisierung am Standort: Das Würzburger Werk sei das am höchsten automatisierte Werk in der Unternehmensgruppe. Neue Produkte und Technologien werden hier erstmals getestet und in Serie gebracht. Wenn alles reibungslos funktioniert, transferiert das Werk die Produktionsverfahren und das gesammelte Wissen an die anderen Motorenstandorte weltweit.
Als Leitwerk kommt Würzburg eine Schlüsselrolle zu: Hier wird stellvertretend für alle Motorenstandorte entschieden, welche Neuerungen eingeführt werden sollen. Kaufer stellt fest: „Implementiert wird nicht nur, was besonders fortschrittlich ist, sondern was letztlich auch wirtschaftlich ist.“
Gleichzeitig steigt mit der zunehmenden Automatisierung auch die Komplexität der Prozesse: Produktionsanlagen und Software-Programme sind miteinander vernetzt. Fällt ein Programm aus, kommt im schlimmsten Fall die ganze Produktion zum Stillstand – in der Automobilbranche mit getakteten Lieferzeiten und anspruchsvollen Kunden bedeutet das einen großen wirtschaftlichen Verlust.
Mithilfe von Kameras in der Produktionshalle kann er sich ein Bild der Lage vor Ort verschaffen. Gleichzeitig schaltet er sich über seinen Computer in die Software der defekten Anlage ein und prüft das Programm auf Fehler. „Funktioniert ein Roboter einmal nicht, liegt es selten an der Mechanik. Meistens wird ein Signal nicht richtig weitergeleitet, was dann zum Stillstand der Anlage führen kann“, erläutert Kaufer. Durch den Know-how-Transfer in die Ferne werden Brose-Mitarbeiter weltweit befähigt, solche Probleme selbstständig zu lösen. Obwohl die Werke untereinander im Wettbewerb stehen, hat Kaufer keine Angst vor einem Wettbewerbsnachteil: „Die Technik entwickelt sich rasant weiter. Das nächste Problem, für das wir eine Lösung generieren müssen, kommt bestimmt.“
Kaufer hofft, dass sein Werk auch in Zukunft weiterhin im produzierenden Gewerbe tätig sein wird. Langfristig werde sich der Standort aber auf seine Kernkompetenzen fokussieren müssen: „Unsere Stärke liegt im Know-how unserer Mitarbeiter und im weltweiten Transfer dieses Wissens.“
Hörakustiker
Das ´Hörgerät´ gibt es nicht mehrvon Constanze Dambach
Im April 1992 gründeten Karl Huth und Georg Dickert das erste Fachgeschäft für Hörgeräteakustik in der Würzburger Innenstadt. Der Kundenandrang war so groß, dass in den darauffolgenden Jahren vier weitere Geschäftsstellen dazu kamen. Nach 24 Jahren übergaben die Gründer die Firma in die Hände der neuen Geschäftsinhaber Martin Weiglein und Mirko Nikolai, die damals bereits seit Jahren für das Unternehmen tätig waren. „Für mich war es eine große Ehre, als Herr Huth und Herr Dickert auf mich zukamen“, erinnert sich Nikolai zurück.
Hörsysteme werden digital
App-gesteuertes Hören
FachkräftemangelHörakustiker gesucht
Mit der Welt kommunizieren
Restaurant
Beef800° macht Digitalisierung schmackhaftvon Katrin Witte
Uniklinik
Operiert von einem Robotervon Regina Schmidt
„Bitte die Schere säubern!“ ertönt es aus dem Lautsprecher im Operationssaal 1 der Klinik und Poliklinik für Urologie, im Zentrum für operative Medizin. Assistent Lukas Koneval wiederholt aus Sicherheitsgründen die Worte des Operateurs. Er betätigt den Knopf eines robotischen Arms. Dieser gehört zur sogenannten Patient Cart, deutsch Patientenwagen, und ist eine semi-automatische Säule. An der sind vier robotische Arme montiert. Die Arme sind mit Geräten bestückt, die in den Bauchraum des Patienten führen und Operationsschritte ausüben. Das Instrument aus Arm Nummer drei wird gelöst. Die Schere, die Dr. Koneval aus der Bauchhöhle des Patienten herauszieht, ist nur einen halben Zentimeter lang. Auch die operativen Zugänge am Patienten – nicht größer als ein Knopfloch.
Doch entgegen des Begriffs des Operationsroboters, führt DaVinci keine selbstständigen Operationen durch. Dirigent ist immer noch ein Operateur, der die Instrumente bedient und jeden Operationsschritt durchführt. Dies tut er von einer Konsole aus, die sich zwei Meter vom Patienten entfernt befindet. „Man könnte sich das wie eine Spielestation mit 3D-Monitor vorstellen“, verbildlicht Koneval. Zwei Joysticks übertragen die Handbewegungen des Operateurs in Echtzeit auf die Instrumente. Bei der heutigen Operation – der Entfernung eines Nierentumors – benötigt der Operateur dafür ein Greifinstrument sowie eine Schere.
Die Urologie verfügt über eine moderne technische OP-Ausstattung, die Patientenakte ist jedoch noch aus Papier. Doch das soll sich ändern: 2019 ist die flächendeckende Einführung der elektronischen Patientenakte geplant. Befunde, Messwerte, Bilder, Diagnosen, Patientenkurven und die Dokumentation auf Station sollen digital gesichert werden, verspricht Prof. Georg Ertl, ärztlicher Direktor der Uniklinik. Auf dem Weg ins sogenannte „Digitale Krankenhaus“, einer digitalen und technischen Neuausstattung der Krankenhausstruktur, sei dies ein notwendiger Schritt.
„Der Vorteil besteht darin, dass Daten viel leichter geschlossen verarbeitet werden können. Es erlaubt zeitgleiche Arbeit darin, einen raschen Informationsfluss und verbessert somit die Qualität unserer Arbeit“, so Prof. Ertl.
Oliver Stenzel vom Verband der Deutschen Universitätsklinika zeigt sich beim Blick auf die Hochschulkliniken zuversichtlich: „Alle Kliniken sind im Zuge der Digitalisierung vorn dabei“.
About
Zum AnfangTechnologie
TechnologieBits, Bytes, Arbeit
Automatisierung und Robotik
Automatisierung und RobotikKollege Roboter?
Wann ist ein Roboter ein Roboter?
Handwerk 4.0
Das führt nicht nur zu geänderten Arbeitsprozessen – manchmal lässt die neue Technik auch alte Baumethoden wieder aufleben:
Cobots – neue KooperationsformenMensch und Maschine
Dabei haben Cobots den Vorteil, lernfähig zu sein. Sie können Handlungen nachahmen und später eigenständig ausführen. Sie sind flexibel einsetzbar und relativ leicht zu handhaben.
Neue KooperationsformenMensch und Maschine
Der größte Markt für Industrieroboter ist Asien, dann folgt Europa noch vor Amerika. Besonders Deutschland sticht heraus, als fünftgrößter Markt hinter den Ländern China, Südkorea, Japan und den USA. Die Roboterdichte in der deutschen Industrie war 2016 weltweit die drittgrößte mit 309 Einheiten auf 10.000 Mitarbeiter. Die größten Abnehmer sind Unternehmen der Automobilbranche, der Elektroindustrie und des Metall- und Maschinenbaus.
Arbeitsplätze und Automatisierunge
Automatisierung und ArbeitsplätzeMacht diese Maschine arbeitslos?
Nehmen Maschinen den Menschen so nach und nach die Arbeit ab?
Angst vor der Maschine?
Jeder zweite Job in Gefahr?
Wen trifft die Automatisierung?
Eine Studie der ING Diba betrachtet die Situation in Deutschland: Insbesondere Büro- und Hilfskräfte sehen sie von der Automatisierung bedroht.
Vorbereitung auf das automatisierte Morgen
Das Bildungssystem sollte nicht nur harte Fakten und berufsspezifisches Wissen vermitteln. Vielmehr sind Fähigkeiten wie Eigenverantwortung, Begeisterungsfähigkeit und Kreativität gefragt. In der neuen Arbeitswelt ist es also nicht mehr nur wichtig, ein verlässlicher Mitarbeiter zu sein, sondern es geht darum, sein individuelles Portfolio an Stärken und Talenten voll auszuschöpfen.
Industrie 4.0
Industrie 4.0Maschinen reden miteinander
Die intelligente Fabrik bestimmt zukünftig die Produktion.
Industrie 4.0Die Rolle der Arbeitnehmer
Industrie 4.0 in Deutschland
Investitionen in Industrie 4.0
Herausforderungen Industrie 4.0
Autonomes Fahren
Autonomes FahrenSelbst fahren lassen
Fünf Stufen zum automatisierten FahrenAutonomes Fahren: Was ist das wirklich? Es gibt fünf Stufen:
Level zwei: Das teilautomatisierte Fahren: Das Fahrzeug kann wenige Aufgaben für den Fahrer übernehmen. Automatisches Einparken gehört zu den üblichen Anwendungen.
Level drei wird als hochautomatisiertes Fahren bezeichnet. Das Auto passt seine Geschwindigkeit dem fließenden Verkehr an. Der Autopilot kann den Fahrer aber immer noch auffordern, das Steuer wieder zu übernehmen.
Level vier definiert die Vollautomatisierung. Das Fahrzeug übernimmt das Fahren und gibt die Gewalt über das Auto dann wieder ab, wenn eine Fahrsituation für den Computer nicht zu bewältigen ist.
Level fünf: das autonome Fahren. Der Mensch wird überflüssig. Das Fahrzeug steuert vollautomatisch das Ziel an. Das autonome oder fahrerlose Fahren ist erreicht.
Weniger Arbeitsplätze durch selbstfahrende Fahrzeuge
Weniger Unfälle durch selbstfahrende Kraftfahrzeuge
Autonomes FahrenWie sicher sind die Daten bei autonomen Fahrzeugen?
Autonome Autos ändern den Stadtverkehr
ElektrofahrzeugeNicht nur autonom, auch elektrisch
Unter den Herstellern hat ein Wettbewerb um die neue Technologie begonnen. Verschiedene Studien versuchen zu analysieren, welcher Autobauer wie gut im Rennen liegt. Links Daten aus einer UBS-Studie: Je größer die Kegel bei einem Hersteller, desto besser sieht die Studie das Potential bei Elektroautos.
Dass Tesla vorne liegt überrascht nicht. Aber auch bei einigen traditionellen Herstellern sehen die Autoren großes Potential, etwa bei Daimler oder Volvo.
Künstliche Intelligenz
Künstliche IntelligenzDer Computer lernt
Das Prinzip der Künstlichen Intelligenz gibt es seit 1956. Eine Gruppe von Wissenschaftlern um Marvin Lee Minsky vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) und John Mc Carthey von der Standford University organisierten einen sechs-wöchigen Workshop, in dessen Namen das erste Mal der Begriff der "Künstlichen Intelligenz" (KI) auftauchte – "Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence". Für die Forscher ist KI ein Computerprogramm, welches intellektuelle Aufgaben von Menschen übernimmt.
Anfänge der Künstlichen IntelligenzComputer bezwingt Schachweltmeister
Maschinelles Lernen"AlphaGo"
Deep Learning“Libratus” blufft
So z.B. bei „Libratus“. Die Erfindern haben einen Algorithmus entwickelt, der beim Poker gegen die weltbesten Pokerspieler gewinnen kann – völlig unabhängig davon, welche Karten er bekommt. Ein Algorithmus entspricht einer Reihe von Anweisungen, die ein Programm zur Lösung eines Problems befolgt – im Fall von „Libratus“ also simpel die Spielregeln von Poker. 2017 lief „Libratus“ bei einem Poker-Tunier auf 50 Servern eines Mega-Rechners. Wenn er anfangs noch verlor, lernte er von Partie zu Partie dazu und verbesserte sich von Tag zu Tag. Wenn seine Gegner nämlich nachts schliefen, analysierte der Super-Computer die Partien vom Tag. Am Ende entwickelte er seine eigene Spiel-Strategie. Ohne dass er jemals dafür programmiert wurde, fing "Libratus" selbstständig an zu ‘Bluffen‘ – eine Spielmethode beim Poker, welche dem Gegner davon überzeugen soll, dass man ein gutes oder schlechtes Blatt auf der Hand hat. Bei jedem Zug brauchte ‘Libratus‘ durchschnittlich neun Sekunden, um seine Karten zu analysieren, die Höhe seines Einsatzes zu bestimmen und parallel die Spielzüge der Gegner einzukalkulieren.
Das Sammeln von Daten
Mein Freund Pepper
Es gibt aber auch schon androide Roboter. Der Unterschied zum humanoiden Kollegen – durch einen menschlichen Körperbau sowie einer simulierten Hautstruktur sehen sie einem Menschen täuschend ähnlich. Eleonide, die 1,70 Meter große Roboter-Frau mit blauen Augen und mittelblonden Haaren kann sprechen, lachen und gestikulieren. Vor kurzem hat die TU Darmstadt sie entwickelt, um zu erforschen, wie Menschen auf Gefühle von androiden Robotern reagieren.
Intelligente Konkurrenz
Aber auch in sozialen Berufen treffen wir schon heute auf intelligente Roboter. Pepper empfängt Kreuzfahrtpassagiere, Werner navigiert Kunden durch Geschäfte, Roreas übt mit Schlaganfall-Patienten das Laufen und Kuscheltier-Robbe Paro soll in sich gekehrte Demenzkranke zum Sprechen animieren.
Werden künstliche Intelligenzen also zunehmend auch soziale Berufe übernehmen? Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit hat berechnet, dass heute 13 Prozent der sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufe durch Computer ersetzt werden könnten. Verhältnismäßig wenig im Vergleich zu den Fertigungsberufen, von denen 83 Prozent von computergesteuerten Maschinen übernommen werden können.
Die Superintelligenz
PolitikKI in der deutschen Industrie
Deswegen hat die Bundesregierung jetzt ein Eckpunktepapier zu KI veröffentlicht.
ArbeitsweltExperten gesucht
Virtual Reality
Immersive TechnologienVirtuelle Realitätenvon Vanessa Möller
Virtual Reality (VR) beschreibt eine Wirklichkeit, welche mithilfe eines Computers erstellt wird. Diese Realität wird mit Bild- und oft ebenfalls mit Tonelementen hergestellt und über Großbildleinwände, Head-Mounted-Displays (VR-Brillen) oder in speziellen Räumen, wie der CAVE (Cave Automatic Virtual Environment), dargestellt. Der Nutzer taucht in die virtuelle Welt ein und kann meistens sogar mit der Technik interagieren, indem er sich bewegt oder spezielle Eingabegeräte benutzt.
Immersive TechnologienObjekte erleben – die CAVE
Genutzt wird die CAVE primär von Forschung und Industrie – z.B. in der Städteplanung, der Planung von Großbauprojekten oder in der Produktentwicklung: ‘Immersive Engineering‘.
Therapie im virtuellen Raum
Augmented RealityDie eigene Realität erweitern
Laut einer Studie der Splendid Research GmbH hat bisher mehr als die Hälfte der Deutschen bereits einmal AR benutzt. Erstaunlich ist jedoch, dass jeder Siebte in dem Moment gar nicht wusste, dass es sich bei der Anwendung um AR handelte. Das zeigt, wie gut manche dieser Techniken bereits in unseren Alltag integriert sind und dass die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt fließend ineinander übergehen können.
Augmented RealityIm Alltag und der Arbeitswelt
Virtual & Augmented Reality in deutschen Unternehmen
Wirtschaft
WirtschaftNeue Aufgaben, neues Wirtschaften?
Gig Economy
Gig Economy und neue Formen der ArbeitGig, Gig, Hurra?
Oder sie sind Marktplatz für verschiedenste Aufgaben: Auf Plattformen wie mylittlejob stellen Unternehmen Aufträge ein, wenn sie eine Übersetzung brauchen, Daten recherchieren möchten oder eine Website designen lassen wollen. Einen Auftrag kann jeder übernehmen – von überall auf der Welt aus.
Klicken, radfahren, abtippen
Oft ist von Gig Work die Rede, wenn Auftragnehmer ortsgebundene Aufträge durchführen und eigenes Kapital einbringen – ihr Auto etwa. Bekannte Beispiele sind Uber oder Apps wie Deliveroo und Lieferando, die Essen auf Rädern ausliefern lassen – Die Betreiber sehen sich selbst nicht als Arbeitgeber, sie vermitteln nur Aufträge, argumentieren sie – und kassieren dafür Provsion.
Der Clickworker hingegen sucht sich nicht nur seinen Auftrag im Internet, er führt ihn auch am PC aus. Oft einfache Aufgaben, die (noch) kein Computer erledigen kann: Einkaufsbelege einsortieren etwa, die Nutzer in eine Rabatt-App geladen haben. Geprägt hat den Clickworker-Begriff die NASA: Sie ließ Fotos von der Marsoberfläche von einer Masse an Laien kategorisieren.
Auch Wettbewerbe gibt es, die an Crowdworker ausgeschrieben werden: Ein Unternehmen lässt sich dann zum Beispiel ein neues Logo designen, die besten drei Vorschläge werden honoriert.
Zahlen, Daten, Fakten zur Gig EconomyCrowdworker: Jung und nebenbei
So arbeitet jeder 12. monatlich als Crowdworker, während nur jeder 16. diese Tätigkeit mindestens einmal in der Woche ausführt. Zudem zeigt sich, dass sich vor allem junge Menschen für diese neue Arbeitsform interessieren. Etwas mehr als die Hälfte der Online-Arbeiter ist jünger als 35 Jahre, wohingegen nur jeder 7. älter als 55 ist.
Die Zahlen zeigen außerdem, dass für die meisten Crowdworking nur ein Nebenverdienst ist. Drei Viertel der deutschen Crowdworker verdienen maximal die Hälfte ihres Gesamteinkommens über Onlinetätigkeiten und von 100 Arbeitern finanzieren sich nur 3 vollständig über das Online-Einkommen. Noch werden Cloudwork und Gigwork nur von wenigen Menschen ernsthaft ausgeübt.
Zwischen Flexibilität und Ausbeutung
Wenn der Algorithmus Auftragnehmer und Kunden zusammenbringt, bleibt für Diskriminierung kein Platz, argumentieren Befürworter der Gig Economy. Schnell und effizient sei die Vermittlung.
Die sozialen Netze und Versicherungsmodelle aber sind auf klassische Arbeitsverhältnisse ausgerichtet – Kritiker warnen vor Problemen: Geringe Bezahlung, fehlende Planungssicherheit, wenig Regulierung und keine soziale Absicherung.
Sozialabgaben und SteuernViel Arbeit, viel Eigenverantwortung
Vor allem Menschen, die hauptberuflich als Crowdworker arbeiten, kümmern sich selbst um ihre Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Dies bestätigt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung über Crowdworker in Deutschlang, laut welcher weit mehr als die Hälfte der hauptberuflichen Crowdworker selbst versichert ist. Den Rest der Vollzeit-Crowdworker machen Schüler und Studenten sowie im Ausland lebende Deutsche aus, die entweder bei den Eltern mitversichert sind oder einem anderen Sozialsystem unterliegen.
Außerdem müssen sich Crowdworker an die Steuervorgaben für Selbstständige und die rechtlichen Rahmenbedingungen halten. Diese sowie die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Crowdworker sind jedoch bisher wenig erforscht. Zwar wird darüber diskutiert, für Crowdworker ein eigenes Angestelltenmodell zu entwickeln, doch bleibt die Frage offen, ob die Unternehmen oder die Onlineplattformen die Arbeitgeber sind.
Regulierung: Bei wem liegt der Ball?
Gig Economy Barke
Gig Economy Jürgens
Zum AnfangGig Economy Hill
Zum AnfangArbeiten 4.0
Flexibler, unabhängiger, unsicherer?Arbeiten 4.0
Gleichzeitig bedeutet immer online sein: Wer immer und überall erreichbar ist, von dem wird auch erwartet, das er immer und überall reagiert – auf die Mail des Vorgesetzten, einen Kollegenanruf oder eine Kundenanfrage.
Umbrüche in der ArbeitsweltFlexibel in Raum, Zeit und Struktur
Inkrementelle Veränderungen? Nein, Zeichen eines größeren Umbruchs, meint Kerstin Jürgens:
Höhere Bildung, mehr Selbstbestimmung?
Faktoren für einen zufriedenstellenden JobGlücklich bei der Arbeit?
Einen Hund mit ins Büro bringen zu dürfen, ist nur für wenige entscheidend. Viel wichtiger scheint es, ein Stück weit selbständig über die Arbeitsbedingungen entscheiden zu können: Home Office und flexible Arbeitszeiten tragen für viele Befragte besonders dazu bei, dass die bei der Arbeit zufrieden sind.
Trennung von Freizeit und BerufImmer erreichbar
Diese Erreichbarkeit wird genutzt und eingefordert. Zwei Drittel der Angestellten sind zumindest gelegentlich zu Hause erreichbar, zeigen Zahlen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Verschwimmt die Grenze zwischen Beruf und Freizeit so zunehmend?
Chancen und Risiken der Flexibilisierung
In einigen Firmen versucht man, mobiles flexibles Arbeiten zu formalisieren:
Zeitdruck und ArbeitslastStress ist jobabhängig
Flexible Arbeitszeiten in verschiedenen BerufenArbeitszeit flexibel einteilen?
Welchen Rahmen setzen wir der neuen Flexibilität?
Startup-Unternehmen
UnternehmensgründungFörderdschungel für Hightech-Startupsvon Manuel Hollenweger
Aber Deutschland landet bei der Gründungsaktivität im aktuellen Weltbank-Ranking nur auf Platz 113 von 190 – und liegt damit sogar noch hinter Staaten wie Mali, Senegal oder Usbekistan. Damit Deutschland hier weiter vorne läge, müsse viel passieren, meint Thomas Heilmann von der CDU:
Staatliche Förderung
Das hohe Anfangsrisiko schreckt Investoren in der wichtigen Startphase oftmals ab. Dadurch bildet sich in der Start-finanzierung eine erhebliche Unterversorgung, welche es für den Staat auszugleichen gilt. So finanzierte sich 2017 etwa jedes dritte Startup durch staatliche Fördermittel, nur jedes fünfte erhielt eine Finanzierung durch private Geld-geber. Besonders der deutsche Wagniskapitalmarkt hinkt im Vergleich zu Ländern wie den USA, Großbritannien oder Israel stark hinterher. Diese Art von Beteiligungskapital benötigen risikobehaftete Hightech Startups jedoch oftmals besonders in der Anfangsphase.
Das stärkste Instrument staatlicher Förderung sind finanzielle Mittel: Das Förderangebot von Bund, Ländern und Kommunen bietet unzählige Zuschuss- und Darlehensprogramme, Stipendien und Preisgelder für Startup-Wettbewerbe. So wurden im letzten Jahr 51 Förderprogramme auf Bundesebene und 187 auf Länderebene identifiziert. Ein Vorteil der staat-lichen Mittel ist der geringe Anteil geforderter Gegenleistung und größere Unabhängigkeit.
BürokratieGründer sehen Verbesserungspotenzial
Koalitionsvertrag verspricht Besserung
Weiter ist die Rede von der „Einführung einer Gründerzeit“ und der Ergänzung bestehender staatlicher Finanzierungs-instrumente um den „Tech Growth Fund“. Dieser soll die Finanzierung in der Wachstumsphase erleichtern, indem Kredite in derselben Höhe gewährt werden, in der vorher Wagniskapital vom Unternehmen eingesammelt wurde. Der Koalitionsvertrag macht keine Angabe zur Höhe des Fonds, laut Medienberichten liegt der Umfang jedoch bei zehn Milliarden Euro.
Auch die Bürokratiebelastung soll in der Startphase „auf ein Mindestmaß“ reduziert werden. In diesem Zusammenhang wird auf das dritte Bürokratieabbaugesetz verwiesen. Gründer werden in den ersten beiden Jahren von der monatlichen Voranmeldung der Umsatzsteuer befreit, Statistikpflichten werden verringert. Das Potential für Reduzierungen der Statistikpflicht wird von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe bis Ende 2019 geprüft. Und auch den Zugang zur Forschungsförderung für Startups möchte man künftig deutlich erleichtern.
Politik & Gesellschaft
Politik & GesellschaftWie reagieren?
Ungleichheit und Digitalisierung
UngleichheitDer aktuelle Standvon Tim Wessels
Die Ursache für diese positive Veränderung ist vor allem der Wohlstandsgewinn in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Anzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, hat sich von 1981 bis 2012 von 44% auf 12,7% verringert. Auf der anderen Seite hat sich beispielsweise innerhalb Deutschlands der Gini-Index zwischen 1985 und 2004 von 44 auf 50 erhöht und ist seitdem auf einem konstanten Level. Der Gini-Index ist das gebräuchlichste Maß für die Beschreibung von Ungleichheit, ein Wert von Null bedeutet völlige Gleichheit, ein Wert von 100 maximale Ungleichheit.
ChancengleichheitDer hat was, was ich nicht hab‘
Ob Ergebnisungleichheit aus ethischer Perspektive legitim ist, darüber lässt sich streiten, da nach dem Leistungsprinzip derjenige, der mehr leistet, am Ende mehr bekommen sollte. Weil es jedoch selbst in einer perfekten Welt voller Chancengleichheit trotzdem zu einer gefühlten Ungleichheit kommen kann, ist die Forderung legitim, die Kluft zwischen Arm und Reich möglichst klein zu halten. Zu oft hat die Realität gezeigt, dass der Mensch dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen. Eine persönlich empfundene Ungleichstellung kann daher negative soziale Auswirkungen haben.
Ungleichheit durch Digitalisierung?

Digitalisierung bewegt in gleichem Maße Politik, Wirtschaft sowie den einzelnen Menschen, da ihre Auswirkungen nahezu alle Gesellschaftsbereiche betreffen. Mit den Änderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, sind Hoffnungen und Ängste verbunden. Aber schafft Digitalisierung überhaupt Ungleichheit?
Negative ZukunftsprognoseZerstörte Existenzen durch Digitalsierung
Ganze Branchen, die zuvor tausende Arbeitsplätze geboten haben, werden durch technologische Innovationen umgekrempelt. Hier entstehen einige neue Arbeitsplätze für Menschen mit digitalem Know How, allerdings werden gleichzeitig viele alte Jobs zerstört.
Die versprochene Freiheit durch zeit- und ortsunabhängige Arbeit wird in prekären Beschäftigungsverhältnissen münden. Das Berufsleben wird geprägt sein von Unbeständigkeit, Nichtplanbarkeit und fehlender sozialer Absicherung. Wenn es weniger feste Beschäftigungsverhältnisse gibt, werden die Menschen künftig als digitale Tagelöhner mit all den Nachteilen eines Selbständigen leben, aber mit digitalen Arbeitern aus Niedriglohnländern konkurrieren.
Positive Zukunftsprognose Sozialer Aufstieg durch Digitalisierung
Bereits heute verfügt jeder Mensch mit Internetzugang über digitale Produktionsmittel, während bisher meist viel Kapital benötigt wurde, um Unternehmungen zu starten. Ob Musik, Videos, Blogs, selbst hergestellte Produkte, oder Dienstleistungen, all diese Dinge können mithilfe digitaler Technologien produziert und global angeboten werden.
Die Digitalisierung schafft räumliche und zeitliche Flexibilität, eine bessere Abstimmung von Arbeit und Privatleben und einen einfacheren Zugang zu Bildung. Auch wenn etwa klassische, eintönige Arbeiten in der Produktion wegfallen werden, können die Betroffenen sich durch digitale Lernplattformen in jeden vorstellbaren Themenbereich einarbeiten. Dieses Wissen kann dann genutzt werden, um in neuen Jobs zu arbeiten.
LösungsansätzeBildung
Um einem solchen Zustand der Massenarbeitslosigkeit entgegenzuwirken, muss dafür gesorgt werden, dass betroffene Arbeitnehmer nicht chancenlos auf dem Arbeitsmarkt stehen. Dies kann nur über eine bedarfsgerechte Bildung funktionieren. Es geht nicht ausschließlich um berufsspezifisches Wissen, sondern es müssen Kompetenzen vermittelt werden, die die Menschen dazu befähigen mit sich ändernden Situationen in der Zukunft zurechtzukommen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung drückt es so aus: „Sie (Arbeitnehmer) müssen fortlaufend die Qualifikationen erwerben, die für eine sich wandelnde Arbeitswelt nötig sind“.
Karl-Heinz Brandl über Digitalisierung & Ungleichheit
Zum AnfangThomas Heilmann Digitalisierung & Ungleichheit
Zum AnfangOliver Suchy: Digitalisierung & Ungleichheit
Zum AnfangDigitalisierung & Arbeitnehmer
Wandel der ArbeitVon Industrie 1.0 zu 4.0
Mit dem Konzept Industrie 4.0 sind in der Gesellschaft sowohl Hoffnungen als auch Ängste verbunden. Einerseits bietet die Digitalisierung Chancen für eine Humanisierung der Arbeits-welt, z.B. durch den Rückgang körperlich schwerer und monotoner Arbeit. Andererseits entstehen, durch die zunehmende Automatisierung von Arbeitsprozessen, auch Rationalisierungspotentiale. Teile der Wissenschaft gehen davon aus, dass das Produktivitätswachstum nicht länger automatisch zu Beschäftigungswachstum führt. So kommt eine Studie der Oxford Martin School zu dem Ergebnis, dass durch die Digitalisierung die Hälfte der heutigen Arbeitsplätze in den USA verloren gehen könnte. Deutlich weniger dramatisch sieht es das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, welche eine Analyse im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) durchführte: Demnach sind nur 12 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland durch Digitalisierung bedroht.
Grenzenlose Entgrenzung?
Psychische Belastung durch Digitalisierung Abschalten!
Trotz dieser Erkenntnisse spricht sich die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) für eine weitere Flexibilisierung aus: Ruhezeiten sollen aufgeweicht und die tägliche Höchstarbeitszeitgrenze ausgedehnt werden.
Mobiles ArbeitenRegulierung? Bei wem liegt der Ball?
DatenschutzDer gläserne Beschäftigte
Selbstbestimmung durch Mitbestimmung
Karl-Heinz Brandl über Mobiles Arbeiten
Zum AnfangOliver Suchy über Mobiles Arbeiten
Zum AnfangAlexander Rabe über Mobiles Arbeiten
Zum AnfangBedingungsloses Grundeinkommen
Bedingungsloses GrundeinkommenGeld ohne Arbeit
Das Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens ist recht einfach: Jeder Bürger bekommt eine zum Leben ausreichende Summe Geld vom Staat und muss dafür keinerlei Gegen-leistung erbringen. Es gibt allerdings verschiedene Über-legungen, welche Leistungen, abgesehen vom BGE, der Staat noch zusätzlich erbringen soll. In einer extremen Variante der Auslegung des BGE, würden jegliche andere staatlichen Beiträge gestrichen. Das heißt, in Deutschland würden nicht nur Hartz IV, sondern auch Kindergeld, Bafög und Steuerfrei-beträge wegfallen. In der Folge würden die Kosten für den bürokratischen Aufwand sinken: Denn, wo jetzt Sachbearbeiter Berechtigungen einfordern und Freibeträge errechnen oder Gerichte Hartz IV-Bescheide verhandeln, stünde mit dem BGE künftig ein fixer Betrag, dessen Auszahlung veranlasst würde.
Problem: Pflege- und Krankenversicherung
Umstritten ist zudem der Umgang mit der Sozialversicherung. Klar ist, dass Renten- und Arbeitslosenversicherung nicht mehr nötig wären, da das Existenzminimum durch ein BGE bereits abgedeckt wäre. Kritischer wäre es beim Thema Kranken- und Pflegeversicherung. Hier wäre eine Organisation unabhängig des Grundeinkommens notwendig.
Aber auch dann wären nicht alle Probleme gelöst: Etwa 3,1 Millionen Menschen haben zum 30. Juni 2017 Leistungen aus der Pflegeversicherung bezogen, rund 776.000 davon hielten sich stationär in einem Pflegeheim auf. Wie die Bundes-regierung 2017 auf Anfrage der Linksfraktion mitteilte, müssen Bewohner eines Pflegeheims im Schnitt 581 Euro pro Monat aus eigenen Mitteln zuzahlen – trotz Pflegeversicherung. Das BGE müsste diese Zuzahlung auffangen, sofern der Pflege-patient über kein zusätzliches Vermögen verfügt. Zudem gibt es an vielen Stellen – beispielsweise bei der Rentenversicherung – feste Leistungszusagen, für die Arbeitnehmer bereits eingezahlt haben. Sie weiterhin auszuzahlen zu können, erfordere wiederum bürokratischen Aufwand.
Höhe des Bedingungslosen Grundeinkommens
Erstaunlich ist, dass trotzt eines bedingungslosen Grundeinkommens der Großteil der Bevölkerung weiterhin arbeiten gehen würde. Lediglich 15 Prozent der Befragten geben an, bei einem BGE von 1.500 Euro ihren Job zu kündigen.
Berlin 2019Solidarisches Grundeinkommen
Bedingungsloses GrundeinkommenTestballon Finnland
BGE in Gesellschaft und PolitikZustimmung und Ablehnung
SPD, CDU, CSU, AfD und FDP lehnen das BGE generell ab. Bei Grünen und Linken gibt es Strömungen, die für ein Grundeinkommen sind, eine Mehrheit fand sich bis dato aber auch dort nicht.
Bedingungsloses GrundeinkommenDigitalisierung und Arbeitsplätze
Während viele Forscher einen massiven Wegfall von Arbeitsplätzen prognostizieren, kommt das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung zu dem Ergebnis, dass durch die Digitalisierung sogar mehr Jobs entstehen. Nur sind diese eben welche für höher Qualifizierte, können nicht von gering qualifizierten Arbeitnehmern übernommen werden.
Digitale Infrastruktur
BreitbandabdeckungNicht den Anschluss verlierenvon Franziska Lehnert
Seitdem das World Wide Web für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wurde die Digitalisierung zum größten Umbruchsfaktor in der Gesellschaft. Sie betrifft alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche. Moderne Landwirtschaft mit Melkrobotern, E-Health in der Medizin, vernetztes und autonomes Fahren, die Industrie 4.0 mit Datenaustausch in Echtzeit, Videostreaming und Virtual Reality-Anwendung – kaum ein privater Nutzer oder Unternehmer kann sich dem digitalen Wandel entziehen. Um als führende Industrienation zu bestehen, muss Deutschland deshalb auch in der digitalen Wirtschaft ein starker Player werden. Wichtigste Voraussetzung dafür: schnelle, belastbare Internetverbindungen.
Gigabit statt Mbit
Zahlen, Daten, FaktenWo liegt der Unterschied?
Die andere Technologie bedient sich des TV-Kabelnetzes. Über sogenannte Koaxialkabel (HFC) beziehen heute rund 70 Prozent der Haushalte Internet. Die dort verfügbaren Downloadgeschwindigkeiten bewegen sich in einer Spanne von 32 bis 400 Mbit/s. Durch das Abschalten von Kabelsendern würden verschiedene Leitungen frei und die Übertragungs-raten ließen sich enorm steigern.
NetzabdeckungGefälle zwischen Stadt und Land
NetzabdeckungEuropäischer Vergleich
Schleppender BreitbandausbauDie Ursachen sind komplex
Mögliche Ursachen für diese Investitionspolitik liegen in der Komplexität des Breitbandausbaus. Insbesondere kleinere Kommunen sind mit der Umsetzung der Förderprojekte überfordert. Es fehlen Baufirmen, manche Förderanträge wurden zurückgezogen. Zusätzlich zu diesem Förderstau kritisiert der EuRH in seinem Sonderbericht, dass die Bunde-sregierung nie die Finanzierungslücke zwischen privaten und öffentlichen Investitionen analysiert hätte. Dabei wäre dies wichtig gewesen, um den tatsächlichen Bedarf an Förder-geldern zu ermitteln; etwa für ländliche Gebiete, in denen es sich für Unternehmen kaum lohnt in teure Glasfaserleitungen zu investieren.
Um den Ausbau zu erleichtern, wurde Ende 2016 das DigiNetz-Gesetz erlassen. Dadurch sollen bei jedem neuen Baugebiet, jeder neuen Straße direkt Glasfaserleitungen mitverlegt werden – bis zum Gebäude (FTTB).
Mobilfunk5-G statt LTE
Digitalisierung & Bildung
Digitale Bildung
Auch Lehrer und Lehrerinnen sind kaum für die neue Herausforderung ausgebildet. Das deutsche Bildungssystem muss aufholen, um in der globalen Wirtschaft nicht abgehängt zu werden. Hier stehen Bund und Länder in der Verantwortung die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.
Digitale BildungInternationaler Vergleich
Im internationalen Vergleich steht das Heimatland des Erfinders des Computers, Konrad Zuse, nur mittelmäßig da, was digitale Bildung anbelangt. So ist Informatik nur in neun Bundesländern ein Pflichtfach und das oft nicht in allen Schulformen und nur als Teil eines Fächerkanons, wie Arbeit-Wirtschaft-Technik. So ist es in Großbritannien und den USA schon seit Jahren üblich, dass Schüler ihre eigenen Endgeräte mit in den Unterricht bringen. Auf der britischen Insel führte der ehemalige Premierminister David Cameron bereits 2014 das Schulfach „Computing“ ein. Und das verpflichtend für alle Schüler ab fünf Jahren. In Estland lernen die Kinder sogar schon ab der ersten Klasse programmieren. Der kleine Balkanstaat ist einer der Vorreiter im digitalen Zeitalter und hat eine der höchsten Dichten an Start-up-Unternehmen pro Einwohner. In insgesamt 15 EU-Ländern steht das Fach Programmieren mittlerweile fest in den Lehrplänen.
FachkräftemangelMINT-Fächer als Schlüsselqualifikationen
Schüler brauchen Medienkompetenz
Milliardenpaket für Ausstattung von SchulenDigitalpakt
Bertelsmann-StudieSchulen brauchen mehr Geld
MediendidaktikLehrer müssen lernen
Globalisierung
Globalisierung und Wandel der ArbeitsweltBloß nicht stillstehenvon Vanessa Möller
Des Weiteren sorgen die globalen Entwicklungen dafür, dass sich unsere Arbeitswelt immer schneller wandelt. Die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer ändern sich stetig und auch Unternehmen laufen Gefahr, den Anschluss zu verlieren, wenn sie sich nicht ständig anpassen. Flexibilität, Kreativität und lebenslanges Lernen sind auf beiden Seiten nötig, um in unserer globalisierten Welt zu bestehen.
Zudem steigt der Wettbewerbsdruck für alle Beteiligten. Während Unternehmen Geschäftsteile in andere Länder verlegen, um dort kostengünstiger produzieren zu können, müssen sich Arbeitnehmer gegen immer mehr Mitbewerber durchsetzen. Denn international tätig sein oder im Ausland arbeiten, ist durch die Globalisierung heutzutage so einfach wie nie.
Transportkosten über die ZeitGünstig um die Welt
Arbeiten bald nur noch Roboter?
Aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-forschung (IAB) und des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) geht jedoch hervor, dass nicht nur Jobs wegfallen, sondern auch neue entstehen. Die Forscher untersuchten die Entwicklung des Gesamtniveaus der Beschäftigung in Deutschland – mit und ohne Digitalisierung. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass bis 2035 etwa 1,5 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, aber gleichzeitig fast genauso viele neue Arbeitsplätze entstehen werden.
Wandel zwischen den Sektoren
Im Gegensatz dazu ist jedoch der tertiäre Sektor, welcher Dienstleistungen und weitere Wirtschaftsbereiche beinhaltet, stark gewachsen. 1950 war jeder dritte Arbeitnehmer im Dienstleistungssektor beschäftigt, während hier heute etwa dreiviertel der deutschen Erwerbstätigen arbeiten. Denn durch die Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung der Welt, ist die Nachfrage nach Dienstleistungen, z.B. im Bereich der IT, des Tourismus und des Gastgewerbe stark gestiegen.
Zwar hat sich die Anzahl der Arbeiter in den jeweiligen Sektoren verschoben, doch hat dies die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland nicht negativ beeinflusst. Mit einer Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent im Jahr 2017 (Statistisches Bundesamt) steht Deutschland gut da.
Neue Chancen für Selbstständige
Dass die Zahl der Selbstständigen seit Jahren steigt, lässt sich, nach der Studie „Digitale Arbeit in Deutschland“ der Friedrich-Ebert-Stiftung aus 2012, auf die zunehmende Digitalisierung zurückführen. In unserer heutigen Welt wird Arbeit immer beweglicher sowie unabhängiger von Ort und Zeit. Bestehende Organisationsstrukturen und Beschäftigungsverhältnisse lockern sich oder lösen sich komplett auf, um in neuer Form zu entstehen.
Über Plattformen wie Upwork oder Freelancer.com können Unternehmen Aufgaben über das Internet outsourcen, welche von Freiberuflern flexibel und selbstständig bearbeitet werden. Die Unternehmen sparen sich Kosten, während sich Freiberufler Arbeitszeit und -ort aussuchen können. So kann es sein, dass ein indischer Freelancer einen Auftrag für ein englisches Unternehmen ausführt, ohne dass beide Parteien sich je zu Gesicht bekommen.
Löhne und Gehälter steigen
Dem entgegen stehen jedoch Zahlen des Statistischen Bundesamts, laut denen Löhne und Gehälter in Deutschland seit über 20 Jahren nahezu jedes Jahr steigen. So waren beispielsweise die Löhne und Gehälter 2017 im Schnitt um 4,5 Prozent höher als 2016. Neben Tarifverhandlungen und dem gesetzlichen Mindestlohn spielen aber hierbei auch Globalisierung und Digitalisierung eine Rolle.
Doch nicht nur in Deutschland verdienen die Menschen mehr Geld. Seit 1990 lässt sich in fast allen Mitgliedsländern der OPEC erkennen, dass die jährlichen Durchschnittseinkommen stetig steigen. Lediglich Griechenland und Island hatten einen großen Einbruch während der Finanzkrise. Das Einkommensniveau von Italien und Mexiko hat sich über die Jahre kaum verändert. In Ländern wie Litauen, Estland und der Slowakei dagegen zeigt sich der positive Effekt einer globalisierten Welt – hier steigen seit Jahren die Durchschnittseinkommen.
Macht global glücklich?
Die Globalisierung wirkt sich jedoch nicht nur auf die Gesamtsituation von Menschen in verschiedenen Ländern aus, sondern auch auf den Arbeitsalltag der Beschäftigten. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse 2016 wandelte sich der Arbeitsplatz bei etwa der Hälfte der Befragten wesentlich in den letzten Jahren. Neue Strukturen und veränderte Arbeitsabläufe bieten zwar einerseits viele Chancen, doch fühlt sich laut der Studie auch jeder Dritte dadurch persönlich belastet.
Unsere Arbeitswelt hat sich durch die Globalisierung und Digitalisierung stark gewandelt und auch in unserer Freizeit spüren wir den Einfluss der vernetzten Welt immer deutlicher. Uns bieten sich fast täglich neue Wege und Chancen, von welchen unsere Großeltern nicht mal wagten zu träumen. Und doch können diese Veränderungen Menschen belasten – manche mehr, manche weniger. Ob die Globalisierung glücklich macht, kann am Ende wohl jeder nur für sich selbst entscheiden.
Digitalisierung & Arbeitgeber
Wachstum, Wettbewerb, WohlstandWie deutsche Arbeitgeber die Digitalisierung der Wirtschaft begreifenvon Karsten Fehr
Chancen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Arbeitswelt 4.0 braucht Arbeitszeit 4.0
Die BDA fordert aber auch eine Umstellung der erlaubten Höchstarbeitszeit pro Tag. Nach heutigem Arbeitszeitgesetz beträgt sie zehn Stunden. Ein Arbeitnehmer muss demnach bei Erreichen dieser Grenze aufhören zu arbeiten, auch wenn der Kunde noch am selben Tag Ergebnisse verlangt. Das sei nicht mehr zeitgemäß, sagen die Arbeitgeber, und fordern deshalb, die Höchstarbeitszeit künftig auf Wochenbasis zu berechnen. So gibt es auch die EU-Arbeitszeitrichtlinie vor: Demnach darf die durchschnittliche Arbeitszeit pro Siebentageszeitraum 48 Stunden nicht überschreiten. Somit könnten Beschäftigte ihre Arbeitszeit wesentlich variabler gestalten und an die jeweilige Auftragslage anpassen, argumentieren die Arbeitgeberverbände.
Ebenfalls reformbedürftig ist nach Ansicht der BDA die geltende Rechtslage zur Aufzeichnungspflicht. So müssen Arbeitgeber sicherstellen, dass die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten jenseits der werktäglichen Arbeit aufgezeichnet werden. Bei einem Verstoß können sie mit einer Geldbuße von bis zu 15 000 Euro belangt werden. Diese Regelung werde den immer flexibler werdenden Arbeitszeitmodellen nicht mehr gerecht, sagen die Arbeitgeber, und schieben die Ver-antwortung von sich: Geht es nach ihnen, sollen künftig die Beschäftigten dafür verantwortlich sein, ihre Arbeitszeit bei einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde nachweisen zu können.
Flexible Arbeits- und Beschäftigungsformen
Der Faktor Flexibilität spiegelt sich auch bei den Be-schäftigungsverhältnissen wider. Das klassische Arbeits-verhältnis wird den Arbeitgeberverbänden zufolge zwar bestehen bleiben. Gleichwohl seien weitere Beschäftigungs-formen notwendig, die der Staat nicht weiter regulieren dürfe. So wollen die Arbeitgeber im digitalen Zeitalter weiterhin auch auf Zeitarbeit und sachgrundlose Befristungen setzen. Die Digitalisierung der Wirtschaft führe zu kurzfristigeren Schwankungen der Auftragslage, denen Beschäftigung folgen müsse, lautet ihre Argumentation. Zeitarbeit und Befristungen seien anständig vergütete Arbeitsverhältnisse und bildeten für viele Menschen eine Brücke von der Arbeitslosigkeit in die Beschäftigung. Der BDA ist zudem davon überzeugt, dass die Digitalisierung Arbeitsteilung und Spezialisierung fördern wird. Um diese Entwicklung zu unterstützen, dürfe man auch den Einsatz von Werk- und Dienstverträgen nicht in Frage stellen.
Starke Tarifbindung gewünscht
Die Digitalisierung der Wirtschaft, davon ist die BDA überzeugt, wird auch schnellere Entscheidungen in Unternehmen erforderlich machen. Verzögerungspotenziale wie eine zu umfassende Mitbestimmung der Belegschaft gelte es entsprechend abzubauen. So dürfe zum Beispiel die Einführung eines gänzlich neuen IT-Systems der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegen, nicht aber jedes erdenkliche Update. Die Balance zwischen unternehmerischer Entscheidungsfreiheit und Mitwirkungsrechten der Beschäftigten müsse auch im digitalen Zeitalter beibehalten werden.
Digitalisierung & Weiterbildung
WeiterbildungLebenslanges Lernen im digitalen Zeitalter
WeiterbildungFlexibler Umgang
Die Arbeitgeberverbände sind davon überzeugt, dass sich in einer Arbeitswelt 4.0 die Anforderungen an die Beschäftigten der mittleren Qualifikationsebene weiterentwickeln werden. Wichtig sei deshalb, die Ausbildungsordnungen flexibel zu halten und kontinuierlich anzupassen. Dabei müsse man die Arbeitgeberseite eng einbinden. In der sogenannten „smart factory“ würden Produktions- und Wissensaufgaben weiter zusammenwachsen. Daher müsse man berufliche und akademische Ausbildung noch stärker miteinander verzahnen.
FachkräftemangelIT-Experten gesucht
Allerdings gibt es nur wenige Studiengänge in diesem Bereich. So listet der Hochschulbidungsreport für das Wintersemester 2017/2018 gerade einmal drei Bachelor- sowie 23 Master-studiengänge, welche einen expliziten Data-Science- oder Big-Data-Bezug aufweisen.
Digitalisierung & Wettbewerb
Wettbewerb auf dem Prüfstand
Wettbewerbspolitik überwacht den Wettbewerb auf den Märkten. Die Aufgabe der Wettbewerbspolitik besteht darin, im Interesse der Verbraucher sowie aller Unternehmen einen funktionsfähigen und nach Möglichkeiten unbeschränkten Wettbewerb zu gewährleisten und nachhaltig zu sichern. Somit werden Unternehmen angetrieben, ihren Kunden die bestmögliche Qualität für einen fairen Preis anzubieten.
MarktmachtbegrenzungWettbewerbsrecht
Soziale Netzwerke, Suchmaschinen und Co: Der digitale Wandel revolutioniert das herkömmliche Wirtschaftsdenken und etabliert neuartige Unternehmensformen. Heutige Großkonzerne wie Amazon, Google und Facebook sind Teil der digitalisierten Wirtschaft und beherrschen mit ihren Produkten und Dienstleistungen Digitalmärkte. Dies birgt die Gefahr von Monopolen. Allerdings sind die digitalisierten Geschäftsformen für das Wettbewerbsrecht Neuland – die Wettbewerbspolitik muss auf noch nie da gewesenes reagieren.
PlattformökonomieHerausforderung für das Wettbewerbsrecht
Der Handel mit Daten
Der Handel mit Daten hat drei Geschäftsmodelle in der digitalisierten Wirtschaft etabliert. Plattformen wie Facebook sind für Werbetreibende interessant, da sie auf Basis der personalisierten Daten ihrer Nutzer zielgruppengerechte Anzeigen schalten. Anbieter, die über Nutzerdaten verfügen, können Werbetreibenden ermöglichen, zielgruppengerechte Werbung zu schalten. Somit verspricht das Unternehmen einen wahrscheinlicheren Werbeerfolg.
Des Weiteren können über Nutzerdaten individuelle Preise kreiert werden. So analysieren Unternehmen Informationen über die individuelle Zahlungsbereitschaft eines Nutzers, um gegebenenfalls einen niedrigeren oder höheren Preis für eine Ware zu verlangen. Das Prinzip ist auch unter dem Begriff Preisdiskriminierung bekannt.
Der steigende Handel mit Daten bedeutet: Daten haben sich im Zuge der Digitalisierung zum neuen Zahlungsmittel des 20. Jahrhunderts entwickelt. Für Wettbewerbsbehörden war die Beurteilung von Paying-With-Data-Konzepten bisher unbekanntes Terrain. Denn ein umsatzschwaches Unternehmen kann durch seine Datenbestände ein wichtiger Akteur im relevanten Markt sein. Beim Fusionskontroll-verfahren von Facebook und Whatsapp 2014 wurden viele Elemente in monetärer Einheit gemessen und bewertet. Die große Anzahl an Daten wurde nicht berücksichtigt. Damit wurde die enorme Machtstellung der Fusion verkannt. Das Bundeskartellamt schätzt, dass der Facebook-Konzern vier Jahre später auf dem Markt sozialer Netzwerke einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent in Deutschland innehat.
Sharing-EconomyIch vermiete dir mein Haus
Marktmacht gleich Monopolmacht?
KartellrechtAnpassung an digitales Zeitalter
Mit der 9. Novelle des GWB wurde auf eine Reihe dieser ökonomischen Entwicklungen reagiert. Sie trat im Juni 2017 in Kraft und bessert Regelungslücken bei Bußgeldhaftungen aus. Des Weiteren stärkt sie Kartellgeschädigte und erleichtert wirtschaftliche Kooperationen von Presseverlagen. Zudem wurde das Ministererlaubnisverfahren reformiert. Doch Hauptanliegen der Gesetzgebung ist ein Ordnungsrahmen für die digitalisierte Wirtschaft. Insgesamt hat die 9. GWB-Novelle der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung von Plattformmärkten Rechnung getragen. Ihr Ziel ist es, das Kartellrecht auf digitale Plattformen und deren ökonomischen Phänomene anzuwenden.
Berechnung der digitalen Marktmacht
Auf Basis dieser Regelung kann das Bundeskartellamt auch solche Zusammenschlüsse und Marktpositionen prüfen, in denen große, etablierte Unternehmen ihre Marktbeherrschung durch die Übernahme umsatzschwacher Unternehmen mit einem hohen wirtschaftlichen Wert begründen oder verstärken wollen. Nicht erkannte gegenwärtige Wettbewerbsverhältnisse und Unterschätzung der Rolle des potenziellen Wettbewerbers, wie bei der Fusion von Whatsapp und Facebook, sind so nicht mehr möglich.
Neben den bisherigen Kriterien des § 18 Abs. 3 GWB sind fortan indirekte und direkte Netzwerkeffekte, Multihoming sowie mögliche Größenvorteile im Zusammenhang mit Netzwerkeffekten berücksichtigt. Um die Marktstellung eines Unternehmens zu bewerten, werden die Anzahl der Nutzer herangezogen, die zum einen durch Netzwerkeffekte beispielsweise ein soziales Netzwerk bevorzugen. Zum anderen werden die User betrachtet, die Multi-Homing betreiben können.
Digitalisierung in Estland
E-EstoniaDigitalisierung in Estlandvon Katrin Witte
Die estnische Politik setzt ihre digitalen Errungenschaften seit Jahren gekonnt in Szene. Mit Begriffen wie „E-Estonia“ oder „E-Staat“ nutzt sie den Fortschritt bewusst für Marketing-zwecke. Doch dahinter steckt mehr als nur heiße Luft: Ein Blick auf den Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) zeigt, dass Estlands Digitalisierung im europäischen Vergleich überdurchschnittlich ist. So belegte der kleine baltische Staat im Ranking den neunten Platz. Deutschland erreichte hingen nur Rang 14.
Der Index ermittelt alljährlich im Auftrag der Europäischen Kommission die Digitalisierungsfortschritte der einzelnen Mitgliedsstaaten. Fünf Kriterien werden zu diesem Zweck bewertet: Neben dem Netzausbau, den digitalen Fertigkeiten der Einwohner, der tatsächlichen Internetnutzung und der Digitalisierung der einheimischen Unternehmen wird ebenfalls untersucht, in welchem Umfang öffentliche Dienste auch online verfügbar sind. Estland lag in fast allen Teildisziplinen über dem EU-weiten Mittelwert. Die Digitalisierung wird also in vielen Bereichen vorbildlich umgesetzt. Doch die Esten haben eine ganz besondere Spezialität: Während sie kulinarisch bei ihrem Nationalgericht auf Blutwurst und Sauerkraut setzen, stehen bei der Digitalisierung die öffentlichen Dienste ganz oben auf der Karte.
E-Governance"X-Road"-Datenautobahn
Grundlage dafür ist die „X-Road“. Diese „Datenautobahn“ bündelt mittlerweile rund 1.000 Dienste und ist dezentral aufgebaut. Die einzelnen Stellen kontrollieren weiterhin ihre eigenen Datenbestände. Es gibt also keine große zentrale Datenbank, die alle Angaben der Bürger und Unternehmen sammelt. Die einzelnen Verwaltungseinheiten haben lediglich Zugriff auf die Daten, die bei anderen Behörden hinterlegt sind.
E-GovernanceVorteile für Bürger
Doch die E-Governance birgt weitere Vorteile: So werden Effizienz und Effektivität gesteigert. Einfache Fragen können dank der digitalen Verfügbarkeit vieler Informationen schnell geklärt werden. Zudem können die Bürger und Unternehmen Erledigungen, für die sie üblicherweise an die Öffnungszeiten der Behörden gebunden waren, zeitunabhängig und mobil erledigen. Vorhandene Daten können optimal genutzt werden. Das beschleunigt viele Abläufe.
Die Esten sind von den Vorteilen überzeugt: Etwa 96 Prozent nutzen digitale öffentliche Dienste. Damit sind sie Spitzenreiter in der EU. In Deutschland gibt es nicht einmal halb so viele Nutzer der E-Governance-Angebote. Das mag auch daran liegen, dass die digitalen Dienste unserer Behörden und Ämter weitaus weniger ausgebaut sind. Im Vergleich ist es so für die Esten wesentlich einfacher, staatliche Leistungen zu nutzen.
GesundheitssystemElektronische Patientenakte
Gesundheitssystem Das digitale Rezept
Mehr als 70 Prozent der Esten nutzen die elektronische Akte, in der auch die Rezepte hinterlegt werden. Doch der Zugriff auf ihre Daten ist nicht unendlich und unkontrolliert. Der Patient kann selbst entscheiden, wer die eigenen Daten erhalten soll und gegebenenfalls den Zugriff verweigern.
Diese Beispiele zeigen, dass einige Defizite des schwachen Gesundheitssystems durch die Digitalisierung abgemildert werden können. Dennoch gaben bei einer Befragung der Word Health Organisation nur wenige Esten an, bei guter Gesundheit zu sein. Mit dem Ergebnis gehört Estland zu den Schlusslichtern der EU. Folglich muss man feststellen, dass auch die digitalen Maßnahmen ihre Grenzen haben und nicht alles ausgleichen können.
BildungssystemAuch Eltern profitieren vom digitalen Klassenbuch
Derartige Lehrmethoden sind nicht verpflichtend. Jeder kann selbst entscheiden in welchem Maße er die elektronischen Hilfestellungen nutzt. Doch am digitalen Klassenbuch kommt fast keiner vorbei vorbei. Hierfür wird die Online-Plattform "e-Kool" genutzt. Diese wird von 85 Prozent der Schulen eingesetzt. Lehrerinnen und Lehrer nutzen das System, um Fehlzeiten einzutragen, einen Unterrichtsplan zur Verfügung zu stellen, Nachrichten von Eltern zu empfangen, Noten einzutragen und um Hausaufgaben aufzugeben. So können Eltern und Schüler den Überblick über die individuellen Leistungen behalten. Die Schulleitung wird durch das System über die Belastung einzelner Lehrkräfte und die Fortschritte der jeweiligen Klassen informiert. Die zuständige Behörde erhält regelmäßig einen automatisch generierten Bericht.
Mit dem System wird der Organisationsaufwand verringert. Zudem können die Fortschritte und Defizite genauer und schneller erfasst werden. Dies führt nicht nur zu Kosteneinsparungen, sondern auch dazu, dass das dadurch gesparte Geld gezielter eingesetzt werden kann.
WeiterbildungLebenslanges Lernen
Der Ausbau digitaler Kompetenzen der Bevölkerung ist den Esten ein zentrales Anliegen. Deshalb setzen sie nicht nur in der Schule darauf, die Kinder und Jugendlichen in diesem Bereich fit zu machen. Auch für Erwachsene gibt es Bildungsangebote. Diese wurden mit der „Lifelong Learning Strategy 2014–2020” beschlossen. Es verwundert also nicht, dass Estland so auch in der Kategorie des Humankapitals bei der DESI-Studie besser als Deutschland und dem EU-Mittelwert abschnitt.
Internet of Things & Regulierung
Internet of Things – smarte Geräte erobern uns
Eine Eigenschaft, die alle IoT-Geräte gemeinsam haben, ist ihre Verbindung mit einem Netzwerk und die Fähigkeit, Daten über das Internet zu sammeln und zu übertragen. Diese Vernetzung bietet Verbrauchern viele Möglichkeiten. Gleichzeitig erhöht sich jedoch auch die Gefahr, dass die Geräte und somit auch die von ihnen verarbeiteten Daten kompromittiert werden. Während die Nutzer von Smartphones oder Tablets inzwischen für Sicherheitsangelegenheiten sensibilisiert sind, fehlt dieses Sicherheitsbewusstsein offenbar für smarte Waschmaschinen oder Babyfone mit Internetzugang.
Das IT-Research- und Beratungsunternehmen Gartner geht davon aus, dass im Jahr 2020 über 25 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden sein werden – der überwiegende Teil davon im Konsumentenbereich. Andere Experten rechnen sogar mit bis zu 100 Milliarden vernetzten Geräten.
Bisher wurden durch Cyberattacken nur Daten gefährdet. Doch mit dem Internet der Dinge kommen jetzt immer mehr vernetzte Geräte mit mangelhafter IT-Security auf den Markt. Sicherheitslücken bringen somit nicht mehr nur Daten, sondern auch die Menschen dahinter in Gefahr. Kann eine staatliche Regulierung die Lösung bringen?
Smarte Geräte machen uns angreifbar
Für die Umsetzung der Botnetze verwendet der Angreifer eine Schadsoftware. Diese überträgt er auf die schlecht gesicherten und mit dem Internet verbundenen Geräte. Auf diese Weise kompromittiert er die Geräte und erlangt Kontrolle über diese. Auf das Kommando des Hackers führen alle infizierten Geräte gleichzeitig einen Angriff auf ausgewählte Computersysteme aus. Dabei kann es sich um eine Webseite handeln, die dann aufgrund der massenhaften Anfragen zusammenbricht. Dieses Vorgehen bezeichnen Experten als Distributed-Denial-of-Service-Angriff (DDoS). Der Besitzer des Gerätes bekommt dabei in der Regel nicht mit, dass Hacker sein Gerät für derartige Angriffe verwenden.
Hacken leicht gemacht
Möglichkeiten einer staatlichen Regulierung Europa-Regelung
Das größte Problem bei einer Durchsetzung eines solchen Mindeststandards stellt allerdings die Überprüfung dar. Hierfür wäre eine kontinuierliche Überarbeitung der Zertifizierung notwendig. Bei der Masse an smarten Geräten, mit der Experten in Zukunft rechnen, wäre dies nur schwierig umzusetzen und zugleich eine finanzielle Herausforderung.
Möglichkeiten der staatlichen RegulierungGütesiegel
Datenschutz
Personalerinj
Digitalisierung mit offener Türvon Frederic Servatius
„Oft kannte man die Mitarbeiter gar nicht mehr persönlich“, erzählt Celia Dustmann von ihrer Zeit als Werkstudentin bei Siemens in Erlangen. Wenn die 32-Jährige davon berichtet, kann man die Ambivalenz in ihrer Stimme hören. Sie spricht von einem hohen strategischen Level, von weltweiter Mitarbeiterbetreuung. Die Prozesse bei Siemens sind schon damals extrem digitalisiert gewesen: „Es lief eigentlich alles über das Online-Tool“, erklärt Dustmann. Jeder Mitarbeiter hat dort seine Kernkompetenzen hinterlegt, die Ziele können abgerufen und mit dem Grad der Zielerreichung verglichen werden. Sogar Nachfolgeregelungen sind dort abgebildet. Sie spricht aber auch davon, dass direkte Kommunikation nur stattgefunden hat, wenn irgendwo Unterlagen fehlten.
Neben Studiengängen und Berufsprofilen hat sich auch die Bewerbung selbst seit Dustmanns Anfängen im Personalbereich verändert: Dass Papierbewerbungen gleich in die Retoure gehen und nicht mehr gesichtet werden, ist ohnehin Standard. Aber auch Bewerbungstools, in denen Anhänge ohne Begrenzung hochgeladen werden können, sind 2018 nicht mehr Stand der Technik.





































































































































































































































































































































































































































































































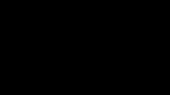

 Wie werden wir in Zukunft arbeiten?
Wie werden wir in Zukunft arbeiten?
 Daniel Barke zur Zukunft der Arbeit
Daniel Barke zur Zukunft der Arbeit
 Dominik Bösl zur Zukunft der Arbeit
Dominik Bösl zur Zukunft der Arbeit
 Verena Gonsch zur Zukunft der Arbeit
Verena Gonsch zur Zukunft der Arbeit
 Steven Hill zur Zukunft der Arbeit
Steven Hill zur Zukunft der Arbeit
 Thomas Ramge zur Zukunft der Arbeit
Thomas Ramge zur Zukunft der Arbeit
 Jochen Steil zur Zukunft der Arbeit
Jochen Steil zur Zukunft der Arbeit
 Ulrich Walwei zur Zukunft der Arbeit
Ulrich Walwei zur Zukunft der Arbeit
 Petra Grimm zur Zukunft der Arbeit
Petra Grimm zur Zukunft der Arbeit
 Kerstin Jürgens zur Zukunft der Arbeit
Kerstin Jürgens zur Zukunft der Arbeit
 Torsten Meireis zur Zukunft der Arbeit
Torsten Meireis zur Zukunft der Arbeit
 Simon Mohr zur Zukunft der Arbeit
Simon Mohr zur Zukunft der Arbeit
 Frank Ackermann zur Zukunft der Arbeit
Frank Ackermann zur Zukunft der Arbeit
 Björn Steinacker zur Zukunft der Arbeit
Björn Steinacker zur Zukunft der Arbeit
 Dorothee Baer zur Zukunft der Arbeit
Dorothee Baer zur Zukunft der Arbeit
 Meera Zaremba über die Zukunft der Arbeit
Meera Zaremba über die Zukunft der Arbeit
 Moritz Hämmerle über die Zukunft der Arbeit
Moritz Hämmerle über die Zukunft der Arbeit
 Oliver Suchy über die Zukunft der Arbeit
Oliver Suchy über die Zukunft der Arbeit
 Alexander Rabe zur Zukunft der Arbeit
Alexander Rabe zur Zukunft der Arbeit
 Thomas Heilmann über die Zukunft der Arbeit
Thomas Heilmann über die Zukunft der Arbeit
 Karl-Heinz Brandl zur Zukunft der Arbeit
Karl-Heinz Brandl zur Zukunft der Arbeit
 Matthias Aust zur Zukunft der Arbeit
Matthias Aust zur Zukunft der Arbeit
 Heute für morgen lernen
Heute für morgen lernen
 Digitale Medien in der Grundschule
Digitale Medien in der Grundschule
 Michaela May
Michaela May
 Astrid-Lindgren-Grundschule in Helmstadt
Astrid-Lindgren-Grundschule in Helmstadt
 Neues lernen im geschützten Raum
Neues lernen im geschützten Raum
 Gestern und Morgen
Gestern und Morgen
 Klassenbuch, Prüfung, Bibliothek – jetzt auch digital
Klassenbuch, Prüfung, Bibliothek – jetzt auch digital
 Dieter Brückner über MEBIS
Dieter Brückner über MEBIS


 Chancen und Herausforderungen
Chancen und Herausforderungen
 Ausbildung
Ausbildung
 Digitalisierung im Handwerk
Digitalisierung im Handwerk
 Andrea Sitzmann
Andrea Sitzmann
 E-Learning Konzepte
E-Learning Konzepte
 "Zahntechnik ist etwas mit Hand, mit Finish und mit Detail, das nicht der Computer alleine lösen kann."
"Zahntechnik ist etwas mit Hand, mit Finish und mit Detail, das nicht der Computer alleine lösen kann."
 Azubi über die Digitalisierung
Azubi über die Digitalisierung
 "Die Auszubildenden werden mehr gefordert durch die Digitalisierung."
"Die Auszubildenden werden mehr gefordert durch die Digitalisierung."
 Und, was hast du heute gemacht?
Und, was hast du heute gemacht?
 ‘Breaking Bad Behavior‘
‘Breaking Bad Behavior‘
 Christian Seufert
Christian Seufert
 Willkommen im virtuellen Klassenzimmer
Willkommen im virtuellen Klassenzimmer
 Ein Klassenzimmer voller Lehrer
Ein Klassenzimmer voller Lehrer
 Von Studierenden für Studierende
Von Studierenden für Studierende
 Christina Huber
Christina Huber
 Streber oder Klassenclown
Streber oder Klassenclown
 Hochschule 4.0
Hochschule 4.0
 Prof. Dr. Phuoc Tran-Gia
Prof. Dr. Phuoc Tran-Gia
 Neue Wege
Neue Wege
 Erfahrungen der Studenten
Erfahrungen der Studenten
 Inverted Classroom
Inverted Classroom
 Thomas Schröter über den Inverted Classroom
Thomas Schröter über den Inverted Classroom
 Wissen: Überall aneignen, unter Anleitung anwenden
Wissen: Überall aneignen, unter Anleitung anwenden
 Neue Aufgaben, neue Rollen?
Neue Aufgaben, neue Rollen?
 Die Zukunft des Geldes
Die Zukunft des Geldes
 Prof. Bofinger über Kryptowährung
Prof. Bofinger über Kryptowährung
 Droht der große Jobverlust?
Droht der große Jobverlust?
 Tweet it!
Tweet it!
 Fragen stellen via App
Fragen stellen via App
 Die Zukunft der Regional- und Außenhandelsforschung
Die Zukunft der Regional- und Außenhandelsforschung
 Prof. Dauth über Künstliche Intelligenz
Prof. Dauth über Künstliche Intelligenz



 Zukunft im Informationsmanagement
Zukunft im Informationsmanagement
 Prof. Flath über die Uni als räumliche Instanz
Prof. Flath über die Uni als räumliche Instanz


 Digitale Projekte
Digitale Projekte
 Die Zukunft der Logistik
Die Zukunft der Logistik
 Prof. Pipernik: Face to Face noch wichtig?
Prof. Pipernik: Face to Face noch wichtig?




 Zukunft der Wirtschaftsinformatik
Zukunft der Wirtschaftsinformatik
 Prof. Winkelmann über Anforderungen an Absolventinnen und Absolventen
Prof. Winkelmann über Anforderungen an Absolventinnen und Absolventen
 Der Hörsaal der Zukunft
Der Hörsaal der Zukunft
 Uni als soziale Plattform
Uni als soziale Plattform
 Podcasts zum Wissenstransfer
Podcasts zum Wissenstransfer
 Zukunft der Lehre
Zukunft der Lehre
 Berufe im Wandel
Berufe im Wandel
 „Halten heißt Schalten“
„Halten heißt Schalten“






 Die Marke Maderner
Die Marke Maderner






 myTaxi und Uber sind eine unfaire Konkurrenz
myTaxi und Uber sind eine unfaire Konkurrenz






 Im Kern zählt immer noch der Mensch
Im Kern zählt immer noch der Mensch
 Holger Loos über die Digitalisierung im Anwaltsberuf
Holger Loos über die Digitalisierung im Anwaltsberuf


 Nutzen Anwälte die Möglichkeiten?
Nutzen Anwälte die Möglichkeiten?



 Wie man die Zeit konserviert
Wie man die Zeit konserviert






 “Kann Doc Morris sowas auch?”
“Kann Doc Morris sowas auch?”








 Kundennähe neu definieren
Kundennähe neu definieren





 Zuverlässig zugestellt
Zuverlässig zugestellt





 Der Kalkulator
Der Kalkulator









 Arbeitsplatz: Überall
Arbeitsplatz: Überall







 „Da muss erst einmal der Gesetzgeber ran“
„Da muss erst einmal der Gesetzgeber ran“







 In keinem Beruf kann man so viel von der Welt sehen
In keinem Beruf kann man so viel von der Welt sehen
 Sechs-Tage-Woche ist normal
Sechs-Tage-Woche ist normal
 Optimale Hotelauslastung
Optimale Hotelauslastung
 Zukunft der Hotelbranche
Zukunft der Hotelbranche

 Schwester Birgitta hat keine Angst vor Robotern
Schwester Birgitta hat keine Angst vor Robotern
 Müthering hilft gerne
Müthering hilft gerne
 Planung per Smartphone
Planung per Smartphone
 Enge Taktung
Enge Taktung
 Digitaler Tourenbegleiter
Digitaler Tourenbegleiter

 Roboter sind nicht emphatisch
Roboter sind nicht emphatisch
 Reagieren oder erschaffen?
Reagieren oder erschaffen?
 Altes Handwerk, neue Technik
Altes Handwerk, neue Technik










 „Digitalisierung ist eine Generationenfrage“
„Digitalisierung ist eine Generationenfrage“








 Wenn Bauherren virtuelle Gebäude betreten
Wenn Bauherren virtuelle Gebäude betreten






 Weinbau mit Gefühl
Weinbau mit Gefühl









 Die digitale Renaissance des Holzbaus
Die digitale Renaissance des Holzbaus










 Wenn Digitalisierung zur wichtigen Backzutat wird
Wenn Digitalisierung zur wichtigen Backzutat wird






 Möbelhandel im Wandel
Möbelhandel im Wandel




 Das A-Team der Solarprojekte
Das A-Team der Solarprojekte







 Wenn digitale Suchbienen fliegen
Wenn digitale Suchbienen fliegen






 „Den digitalen Wandel können wir nicht aufhalten“
„Den digitalen Wandel können wir nicht aufhalten“









 Das ´Hörgerät´ gibt es nicht mehr
Das ´Hörgerät´ gibt es nicht mehr

 Hörsysteme werden digital
Hörsysteme werden digital
 App-gesteuertes Hören
App-gesteuertes Hören
 Hörakustiker gesucht
Hörakustiker gesucht
 Mit der Welt kommunizieren
Mit der Welt kommunizieren
 Beef800° macht Digitalisierung schmackhaft
Beef800° macht Digitalisierung schmackhaft


 Simon Mohr über Vorteile der Digitalisierung
Simon Mohr über Vorteile der Digitalisierung



 Simon Mohr: Die Küche wird digital
Simon Mohr: Die Küche wird digital


 Operiert von einem Roboter
Operiert von einem Roboter






 Über dieses Projekt
Über dieses Projekt
 Bits, Bytes, Arbeit
Bits, Bytes, Arbeit
 Kollege Roboter?
Kollege Roboter?
 Jochen Steil: Zukunft der Automatisierung
Jochen Steil: Zukunft der Automatisierung
 Wann ist ein Roboter ein Roboter?
Wann ist ein Roboter ein Roboter?
 Jochen Steil über Automatisierung und Robotik
Jochen Steil über Automatisierung und Robotik
 Handwerk 4.0
Handwerk 4.0
 Stefan Weyer über Automatisierung und traditionelle Herstellung
Stefan Weyer über Automatisierung und traditionelle Herstellung
 Mensch und Maschine
Mensch und Maschine
 Mensch und Maschine
Mensch und Maschine
 Jochen Steil: Herausforderungen für die Zukunft
Jochen Steil: Herausforderungen für die Zukunft
 Macht diese Maschine arbeitslos?
Macht diese Maschine arbeitslos?
 Ulrich Walwei: Droht technologische Arbeitslosigkeit?
Ulrich Walwei: Droht technologische Arbeitslosigkeit?
 Angst vor der Maschine?
Angst vor der Maschine?
 Wen trifft die Automatisierung?
Wen trifft die Automatisierung?
 Ulrich Walwei: Studien zum Arbeitsplatzverlust
Ulrich Walwei: Studien zum Arbeitsplatzverlust
 Vorbereitung auf das automatisierte Morgen
Vorbereitung auf das automatisierte Morgen
 Ulrich Walwei: Wie bereiten wir uns vor?
Ulrich Walwei: Wie bereiten wir uns vor?
 Maschinen reden miteinander
Maschinen reden miteinander
 Was ist Industrie_4.0?
Was ist Industrie_4.0?
 Professur Ruskowski über IoT
Professur Ruskowski über IoT
 Die Rolle der Arbeitnehmer
Die Rolle der Arbeitnehmer
 Professor Zühlke über die Rolle des Menschen
Professor Zühlke über die Rolle des Menschen
 Industrie 4.0 in Deutschland
Industrie 4.0 in Deutschland
 Investitionen in Industrie 4.0
Investitionen in Industrie 4.0
 Prof. Zühlke über Industrie 4.0 in Deutschland
Prof. Zühlke über Industrie 4.0 in Deutschland
 Herausforderungen Industrie 4.0
Herausforderungen Industrie 4.0
 Prof. Zühlke über Industrie 4.0 auf dem globalen Markt
Prof. Zühlke über Industrie 4.0 auf dem globalen Markt
 Selbst fahren lassen
Selbst fahren lassen
 Fünf Stufen zum automatisierten Fahren
Fünf Stufen zum automatisierten Fahren
 Christoph Reifenrath über das Fahrerlebnis im selbstfahrenden Auto
Christoph Reifenrath über das Fahrerlebnis im selbstfahrenden Auto
 Weniger Arbeitsplätze durch selbstfahrende Fahrzeuge
Weniger Arbeitsplätze durch selbstfahrende Fahrzeuge
 Weniger Unfälle durch selbstfahrende Kraftfahrzeuge
Weniger Unfälle durch selbstfahrende Kraftfahrzeuge
 Petra Grimm über Verantwortung beim autonomen Fahren
Petra Grimm über Verantwortung beim autonomen Fahren
 Wie sicher sind die Daten bei autonomen Fahrzeugen?
Wie sicher sind die Daten bei autonomen Fahrzeugen?
 Petra Grimm über Datenschutz
Petra Grimm über Datenschutz
 Autonome Autos ändern den Stadtverkehr
Autonome Autos ändern den Stadtverkehr
 Nicht nur autonom, auch elektrisch
Nicht nur autonom, auch elektrisch
 Christoph Reifenrath über die Veränderung des Stadtbildes durch autonome Fahrzeuge
Christoph Reifenrath über die Veränderung des Stadtbildes durch autonome Fahrzeuge
 Der Computer lernt
Der Computer lernt
 Computer bezwingt Schachweltmeister
Computer bezwingt Schachweltmeister
 "AlphaGo"
"AlphaGo"
 “Libratus” blufft
“Libratus” blufft
 Thomas Ramge bringt Beispiele für Künstliche Intelligenz
Thomas Ramge bringt Beispiele für Künstliche Intelligenz
 Das Sammeln von Daten
Das Sammeln von Daten
 Mein Freund Pepper
Mein Freund Pepper
 Prof. Ruskowski über Künstliche Intelligenz
Prof. Ruskowski über Künstliche Intelligenz
 Intelligente Konkurrenz
Intelligente Konkurrenz
 Thomas Ramge über Empathie von Maschinen
Thomas Ramge über Empathie von Maschinen
 Die Superintelligenz
Die Superintelligenz
 Thomas Ramge über die Superintelligenz
Thomas Ramge über die Superintelligenz
 KI in der deutschen Industrie
KI in der deutschen Industrie
 Dorothee Baer zu KI in Deutschland
Dorothee Baer zu KI in Deutschland
 Experten gesucht
Experten gesucht
 Virtuelle Realitäten
Virtuelle Realitäten
 Objekte erleben – die CAVE
Objekte erleben – die CAVE
 Wofür Immersive Engineering?
Wofür Immersive Engineering?
 Therapie im virtuellen Raum
Therapie im virtuellen Raum
 Die eigene Realität erweitern
Die eigene Realität erweitern
 Im Alltag und der Arbeitswelt
Im Alltag und der Arbeitswelt
 Anwendung von Augmented Reality im Warenlager
Anwendung von Augmented Reality im Warenlager
 Virtual & Augmented Reality in deutschen Unternehmen
Virtual & Augmented Reality in deutschen Unternehmen
 Matthias Aust über die Gefahr des Wegfalls von Arbeitsplätzen
Matthias Aust über die Gefahr des Wegfalls von Arbeitsplätzen
 Neue Aufgaben, neues Wirtschaften?
Neue Aufgaben, neues Wirtschaften?
 Gig, Gig, Hurra?
Gig, Gig, Hurra?
 Daniel Barke: mylittlejob
Daniel Barke: mylittlejob
 Klicken, radfahren, abtippen
Klicken, radfahren, abtippen
 Crowdworker: Jung und nebenbei
Crowdworker: Jung und nebenbei
 Zwischen Flexibilität und Ausbeutung
Zwischen Flexibilität und Ausbeutung
 Steven Hill: Herausforderungen der Gig Economy
Steven Hill: Herausforderungen der Gig Economy
 Viel Arbeit, viel Eigenverantwortung
Viel Arbeit, viel Eigenverantwortung
 Regulierung: Bei wem liegt der Ball?
Regulierung: Bei wem liegt der Ball?

 Kerstin Jürgens: Lösungen
Kerstin Jürgens: Lösungen
 Steven Hill: Lösungen
Steven Hill: Lösungen
 Arbeiten 4.0
Arbeiten 4.0
 Kerstin Jürgens: Was ist Arbeiten 4.0?
Kerstin Jürgens: Was ist Arbeiten 4.0?
 Flexibel in Raum, Zeit und Struktur
Flexibel in Raum, Zeit und Struktur
 Höhere Bildung, mehr Selbstbestimmung?
Höhere Bildung, mehr Selbstbestimmung?
 Kerstin Jürgens: Wie groß ist der Umbruch?
Kerstin Jürgens: Wie groß ist der Umbruch?
 Glücklich bei der Arbeit?
Glücklich bei der Arbeit?
 Torsten Meireis: Verschwimmen von Beruf und Freizeit
Torsten Meireis: Verschwimmen von Beruf und Freizeit
 Chancen und Risiken der Flexibilisierung
Chancen und Risiken der Flexibilisierung
 Stress ist jobabhängig
Stress ist jobabhängig
 Constanze Kurz: Chancen und Risiken der Flexibilisierung
Constanze Kurz: Chancen und Risiken der Flexibilisierung
 Arbeitszeit flexibel einteilen?
Arbeitszeit flexibel einteilen?
 Constanze Kurz: Weichenstellungen
Constanze Kurz: Weichenstellungen
 Förderdschungel für Hightech-Startups
Förderdschungel für Hightech-Startups
 Thomas Heilmann zur geringen Gründungsaktivität in Deutschland
Thomas Heilmann zur geringen Gründungsaktivität in Deutschland
 Staatliche Förderung
Staatliche Förderung
 Gründer sehen Verbesserungspotenzial
Gründer sehen Verbesserungspotenzial
 Koalitionsvertrag verspricht Besserung
Koalitionsvertrag verspricht Besserung
 Wie reagieren?
Wie reagieren?
 Der aktuelle Stand
Der aktuelle Stand
 Alexander Rabe über Vorteile der Digitalisierung
Alexander Rabe über Vorteile der Digitalisierung
 Der hat was, was ich nicht hab‘
Der hat was, was ich nicht hab‘
 Ungleichheit durch Digitalisierung?
Ungleichheit durch Digitalisierung?
 Zerstörte Existenzen durch Digitalsierung
Zerstörte Existenzen durch Digitalsierung
 Sozialer Aufstieg durch Digitalisierung
Sozialer Aufstieg durch Digitalisierung
 Bildung
Bildung
 Oliver Suchy über lebenslanges Lernen
Oliver Suchy über lebenslanges Lernen
 Karl-Heinz Brandl über Digitalisierung & Ungleichheit
Karl-Heinz Brandl über Digitalisierung & Ungleichheit
 Thomas Heilmann über Digitalisierung & Ungleichheit
Thomas Heilmann über Digitalisierung & Ungleichheit
 Oliver Suchy über Digitalisierung & Ungleichheit
Oliver Suchy über Digitalisierung & Ungleichheit
 Von Industrie 1.0 zu 4.0
Von Industrie 1.0 zu 4.0
 Dorothee Baer zu Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung
Dorothee Baer zu Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung
 Grenzenlose Entgrenzung?
Grenzenlose Entgrenzung?
 Thomas Heilmann: Flexibilisierung und Arbeitnehmerschutz
Thomas Heilmann: Flexibilisierung und Arbeitnehmerschutz
 Abschalten!
Abschalten!
 Der gläserne Beschäftigte
Der gläserne Beschäftigte
 Oliver Suchy zur digitalen Überwachung
Oliver Suchy zur digitalen Überwachung
 Selbstbestimmung durch Mitbestimmung
Selbstbestimmung durch Mitbestimmung
 Oliver Suchy: Mitbestimmung statt Beteiligung
Oliver Suchy: Mitbestimmung statt Beteiligung
 Karl-Heinz Brandl fordert Recht auf Nichterreichbarkeit
Karl-Heinz Brandl fordert Recht auf Nichterreichbarkeit
 Oliver Suchy: Gestzlicher Rahmen für mobiles Arbeiten
Oliver Suchy: Gestzlicher Rahmen für mobiles Arbeiten
 Alexander Rabe: Mobiles Arbeiten braucht Absprachen
Alexander Rabe: Mobiles Arbeiten braucht Absprachen
 Geld ohne Arbeit
Geld ohne Arbeit
 Problem: Pflege- und Krankenversicherung
Problem: Pflege- und Krankenversicherung
 Höhe des Bedingungslosen Grundeinkommens
Höhe des Bedingungslosen Grundeinkommens
 Meera Zaremba über Höhe des BGE
Meera Zaremba über Höhe des BGE
 Solidarisches Grundeinkommen
Solidarisches Grundeinkommen
 Testballon Finnland
Testballon Finnland
 Zustimmung und Ablehnung
Zustimmung und Ablehnung
 Digitalisierung und Arbeitsplätze
Digitalisierung und Arbeitsplätze
 Oliver Suchys Meinung zum BGE
Oliver Suchys Meinung zum BGE
 Nicht den Anschluss verlieren
Nicht den Anschluss verlieren
 Alexander Rabe über den Breitbandausbau
Alexander Rabe über den Breitbandausbau
 Gigabit statt Mbit
Gigabit statt Mbit
 Wo liegt der Unterschied?
Wo liegt der Unterschied?
 Gefälle zwischen Stadt und Land
Gefälle zwischen Stadt und Land
 Europäischer Vergleich
Europäischer Vergleich
 Thomas Heilmann über Breitbandausbau in Deutschland
Thomas Heilmann über Breitbandausbau in Deutschland
 Die Ursachen sind komplex
Die Ursachen sind komplex
 Dorothee Baer: Stand des Breitbandausbaus
Dorothee Baer: Stand des Breitbandausbaus
 5-G statt LTE
5-G statt LTE
 Digitale Bildung
Digitale Bildung
 Internationaler Vergleich
Internationaler Vergleich
 Oliver Suchy: Softskills sind wichtiger als Programmierkenntnisse
Oliver Suchy: Softskills sind wichtiger als Programmierkenntnisse
 MINT-Fächer als Schlüsselqualifikationen
MINT-Fächer als Schlüsselqualifikationen
 Dorothee Baer über IT in der Schule
Dorothee Baer über IT in der Schule
 Schüler brauchen Medienkompetenz
Schüler brauchen Medienkompetenz
 Karl-Heinz Brandl zu Kompetenzen von Schülern
Karl-Heinz Brandl zu Kompetenzen von Schülern
 Milliardenpaket für Ausstattung von Schulen
Milliardenpaket für Ausstattung von Schulen
 Alexander Rabe: Handlungsbedarf beim Bildungssystem
Alexander Rabe: Handlungsbedarf beim Bildungssystem
 Schulen brauchen mehr Geld
Schulen brauchen mehr Geld
 Alexander Rabe über Folgekosten von IT-Ausstattung an Schulen
Alexander Rabe über Folgekosten von IT-Ausstattung an Schulen
 Lehrer müssen lernen
Lehrer müssen lernen
 Alexander Rabe über Lehrerbildung
Alexander Rabe über Lehrerbildung
 Bloß nicht stillstehen
Bloß nicht stillstehen
 Günstig um die Welt
Günstig um die Welt
 Arbeiten bald nur noch Roboter?
Arbeiten bald nur noch Roboter?
 Wandel zwischen den Sektoren
Wandel zwischen den Sektoren
 Neue Chancen für Selbstständige
Neue Chancen für Selbstständige
 Löhne und Gehälter steigen
Löhne und Gehälter steigen
 Macht global glücklich?
Macht global glücklich?
 Wie deutsche Arbeitgeber die Digitalisierung der Wirtschaft begreifen
Wie deutsche Arbeitgeber die Digitalisierung der Wirtschaft begreifen
 Chancen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Chancen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber
 Arbeitswelt 4.0 braucht Arbeitszeit 4.0
Arbeitswelt 4.0 braucht Arbeitszeit 4.0
 Thomas Heilmann über Flexibilisierung der Arbeitszeit
Thomas Heilmann über Flexibilisierung der Arbeitszeit
 Flexible Arbeits- und Beschäftigungsformen
Flexible Arbeits- und Beschäftigungsformen
 Dorothee Baer über neue Arbeitsformen
Dorothee Baer über neue Arbeitsformen
 Starke Tarifbindung gewünscht
Starke Tarifbindung gewünscht
 Lebenslanges Lernen im digitalen Zeitalter
Lebenslanges Lernen im digitalen Zeitalter
 Karl-Heinz Brandl über Bildungsteilzeit
Karl-Heinz Brandl über Bildungsteilzeit
 Flexibler Umgang
Flexibler Umgang
 IT-Experten gesucht
IT-Experten gesucht
 Karl-Heinz Brandl zu IT-Fachkräftemangel in Unternehmen
Karl-Heinz Brandl zu IT-Fachkräftemangel in Unternehmen
 Wettbewerb auf dem Prüfstand
Wettbewerb auf dem Prüfstand
 Wettbewerbsrecht
Wettbewerbsrecht
 Herausforderung für das Wettbewerbsrecht
Herausforderung für das Wettbewerbsrecht
 Der Handel mit Daten
Der Handel mit Daten

 Ich vermiete dir mein Haus
Ich vermiete dir mein Haus
 Marktmacht gleich Monopolmacht?
Marktmacht gleich Monopolmacht?
 Anpassung an digitales Zeitalter
Anpassung an digitales Zeitalter
 Berechnung der digitalen Marktmacht
Berechnung der digitalen Marktmacht
 Digitalisierung in Estland
Digitalisierung in Estland
 "X-Road"-Datenautobahn
"X-Road"-Datenautobahn
 Vorteile für Bürger
Vorteile für Bürger
 Elektronische Patientenakte
Elektronische Patientenakte
 Das digitale Rezept
Das digitale Rezept
 Auch Eltern profitieren vom digitalen Klassenbuch
Auch Eltern profitieren vom digitalen Klassenbuch
 Lebenslanges Lernen
Lebenslanges Lernen
 Internet of Things – smarte Geräte erobern uns
Internet of Things – smarte Geräte erobern uns
 Smarte Geräte machen uns angreifbar
Smarte Geräte machen uns angreifbar
 Hacken leicht gemacht
Hacken leicht gemacht
 Alexander Rabe über IoT-Sicherheit
Alexander Rabe über IoT-Sicherheit
 Europa-Regelung
Europa-Regelung
 Gütesiegel
Gütesiegel
 Datenschutz
Datenschutz
 Constanze Kurz zur Zukunft der Arbeit
Constanze Kurz zur Zukunft der Arbeit
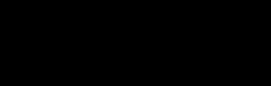 Digitalisierung mit offener Tür
Digitalisierung mit offener Tür